Die einen wollen die Diskriminierung von Frauen und Minderheiten beseitigen, die anderen fürchten Zwang und Bevormundung – um die geschlechtergerechte Sprache in Deutschland ist ein Kulturkampf entbrannt. Besonders heftig tobt er im Internet. Zwischen die Fronten geraten ist eine seit über 100 Jahren allseits anerkannte Institution normativer Rechtschreibung und korrekter Ausdrucksformen – der Duden.
Doch im Auge des Orkans herrscht Gelassenheit. Kathrin Kunkel-Razum, die Chefin der Berliner Duden-Redaktion, empfängt den Besucher ebenso freundlich wie unaufgeregt. Dabei könnte sie durchaus gereizter Stimmung sein, denn in den sozialen Medien wird die promovierte Germanistin
seit Monaten wüst beschimpft, als verantwortliche Frau hinter „Sprachzerstörung“ und „Gender-Gaga“. Kiloweise stellt der Postbote wortgleich formulierte Protestschreiben zu, organisierte Massenaktionen, hinter denen unter anderen Sven von Storch steckt, der Ehemann der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch.
Wie kann jemand, der sich seit langer Zeit kompetent und professionell um die Pflege der deutschen Sprachkultur verdient macht, plötzlich zur Zielscheibe bisweilen fanatischer Aktivisten werden, die „Sprachpolitik“ als Hebel in der wütenden Auseinandersetzung um „Identität“ und „Diversität“ zu nutzen versuchen? Alles nur ein Missverständnis? Jedenfalls glaubt Kathrin Kunkel-Razum, dass „es immer noch zu wenig bekannt“ ist, wie die Duden-Redaktion arbeitet, nämlich weder „heimlich“, wie es manche Kritiker unterstellen, noch mit einem bestimmten Auftrag. „Wir können
nichts verordnen“, stellt die 61-jährige Potsdamerin klar,“wir setzen Leitplanken und ermöglichen Orientierung, und zwar auf der Basis dessen, was wir sehen.“
Tatsächlich ist es ein gleichermaßen transparentes wie plausibles Verfahren, nach dem entschieden wird, welche Wörter in den Duden aufgenommen werden, ob in der gedruckten (148 000 Stichwörter) oder in der Online-Version (250 000). Basis der redaktionellen Empfehlungen ist der
„Dudenkorpus“, in den automatisiert jeden Monat über 25 000 Texte aus Zeitungen, Büchern, Reden und Gebrauchsanweisungen aufgenommen werden. Derzeit umfasst dieses Register sechs Milliarden Wortformen, die mehr oder weniger häufig auftauchen. An der Trefferquote lässt sich
ablesen, ob eine bestimmte Formulierung wesentlich öfter als in der Vergangenheit benutzt wird, zum Beispiel die „Doppelform“ eines Substantivs, die männliches und weibliches Geschlecht zusammenbindet – durch Genderstern, Binnen-I, Doppelpunkt oder Unterstrich („Bürger*in“,
„MieterIn“, „Kolleg:in“, „Schüler_in“).
Alle neuen Einträge der Redaktion durchlaufen eine strenge Prüfung, und selbst wenn sie es in die Printausgabe oder in den digitalen Duden geschafft haben, handelt es sich keineswegs um sakrosankte Vorschriften, sondern nur um das Abbild des aktuellen Sprachgebrauchs. Seit der heftig umstrittenen Rechtschreibreform von 1996 trägt nämlich der „Rat für deutsche Rechtschreibung“ die Verantwortung für den „amtlichen“ Gebrauch des Deutschen, ein Gremium von 41 Wissenschaftlern und Praktikern aus sieben Ländern und Regionen, in denen Deutsch gesprochen
wird. Als maßgebliche Instanz, ausgestattet mit quasi staatlicher Autorität, befand der Rat damals, dass „Schifffahrt“, „Gämse“ und „platzieren“ als regelgerecht gelten, nicht mehr „Schiffahrt“, „Gemse“ und „plazieren“.
Die Aufregung, die es um die Rechtschreibreform gab, hat Kathrin Kunkel-Razum noch in lebhafter Erinnerung, schließlich war sie just zu jener Zeit in der Duden-Redaktion gelandet. „Jetzt ist es fast noch emotionaler“, befindet sie. Dabei sind es keineswegs bloß die selbst ernannten
Lordsiegelbewahrer einer vermeintlichen Sprachreinheit, die gegen den „Gender-Wahnsinn“ zu Felde ziehen. Auch profunde Kenner der deutschen Sprache – Germanisten, Linguisten, Publizisten, Schriftsteller – sind offen auf Distanz zu den Bemühungen gegangen, „sexistischen Sprachgebrauch“ aus dem Deutschen zu tilgen. So kritisiert der „Verein Deutsche Sprache“, der schon vor Jahrzehnten gegen Teile der Rechtschreibreform polemisierte, neuerdings „sprachpolizeiliche Genderregeln“, wo es in Wahrheit doch gar keine geschlechtsspezifischen Nachteile gebe: Wenn jemand im Notfall nach einem „Arzt“ rufe, sei unbestritten, dass auch eine
Medizinerin willkommen sei, heißt es. Im Fachjargon ist vom „generischen Maskulinum“ die Rede, der geschlechtsneutralen Verwendung einer Berufsbezeichnung.
Der Vorwurf lautet, die Duden-Redaktion sei dabei, das generische Maskulinum zugunsten einer „political correctness“ abzuschaffen, einer angeordneten „Haltung“. Tatsächlich passiert ist dies: Vor knapp einem Jahr haben Kathrin Kunkel-Razum und ihr Team damit begonnen, ungefähr 12
000 Einträge im Online-Wörterbuch zu ergänzen. So steht bei „Ärztin“ nicht mehr nur: „siehe Arzt“, sondern:“weibliche Person, die nach Medizinstudium und klinischer Ausbildung die staatliche Zulassung (Approbation) erhalten hat, Kranke zu behandeln.“ Ähnlich verfahren wurde bei „Mieterin“ oder „Bürgerin“. Zuvor hatte es zahlreiche Beschwerden von Nutzerinnen gegeben – „zu Recht“, meint die Duden-Chefin.
Manchmal freilich ärgert sich Kathrin Kunkel-Razum auch über Attacken auf den Duden. So monierte der Leiter des Hamburger Literaturhauses, Rainer Moritz, jüngst den zunehmenden Wunsch, im Zuge sprachlicher Gleichberechtigung „Sprache zu lenken und Kultur zu ’säubern’“ und
nannte als abschreckende Beispiele die Wortformen „Bösewichtin“ und „Gästin“, die der Duden „wörterbuchfähig“ gemacht habe. Dass es die „Gästin“ ebenso wie die „Menschin“ schon vor vielen Jahren in den Sprachführer schafften und übrigens auch bereits 1864 in Grimms Wörterbuch, scheint nicht einmal ausgewiesene Experten in ihrem Furor zu interessieren.
Differenzierte fällt das Urteil von Peter Schneider aus. Der Berliner Autor und Übersetzer gehört – anders als sein verstorbener Freund Günter Grass – nicht zu jenen Dichtern, die sich konsequent den Vorgaben der deutschen Rechtschreibreform verweigerten. Und auch in der Genderdebatte nimmt
Schneider eine ausgewogene Haltung ein. Er respektiert den legitimen Wunsch, „die Rolle und Leistung der Frauen in der Sprache sichtbarer zu machen“, fragt sich aber, ob die neuen Schreibweisen mit Gendersternchen und den anderen Varianten wirklich „geeignet sind, die gesellschaftliche Stellung von Frauen zu verbessern“. Schneider:“Mich stört ein gewisser Hochmut, mit dem sich eine sehr sichtbare Gruppe von Akademikerinnen und Moderatorinnen zu Wortführerinnen der ‚unsichtbaren Frauen‘ aufwirft.“
Noch ein Missverständnis, meint Kathrin Kunkel-Razum:“Natürlich wird keine Schriftstellerin gezwungen, literarische Werke zu gendern. Es geht in erster Linie um Verwaltungssprache.“ Aber klar sei auch, dass Behördensprache auf andere Bereiche ausstrahle und „einen gewissen sozialen Druck“ bewirke. Gegenwärtig befinde man sich „auf einem Experimentierfeld“, und diesen Zustand müsse man noch eine Weile aushalten:“Mit der Zeit werden sich Regeln herausbilden.“ So wie
schon seit Jahrhunderten. Dieser Prozess wird nicht ohne Kontroversen, Irritationen und Verletzungen ablaufen wird, denn:“Es wird für dieses komplexe System der Sprache nie ganz einfache Regeln geben, und es wird sich auch nicht alles regeln lassen“, sagt die Duden-Chefin.
Gewiss wäre es hilfreich, wenn der „Rat für deutsche Rechtschreibung“ sich zu einer „Entscheidung für geschlechtergerechte Schreibungen“ durchringen könnte, „natürlich nur im Sinne einer Tolerierung, nicht als Vorschrift“, sagt Kathrin Kunkel-Razum. Die Amtszeit des Gremiums in
seiner aktuellen Besetzung endet mit Ablauf des Jahres 2022. Offen ist, was der Rat in seinem Abschlussbericht empfiehlt – dass er das heiße Eisen nicht anpackt, ist höchst unwahrscheinlich.
Dazu sind die Gräben zu tief, die in der „Schlacht um das geschlechtergerechte Deutsch“ bereits aufgerissen wurden. So jedenfalls sieht es Henning Lobin (56), Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim. Allerdings warnt der Linguist vor allzu rigiden Eingriffen offizieller Institutionen, schließlich sei die deutsche Sprache bisher gut damit gefahren, sich durch „Gebrauchskonventionen“ gleichsam selbst zu regulieren. Außerdem sei Deutsch im Vergleich zu anderen Sprachen schon heute „ein Symbol der Gleichberechtigung, ein Ergebnis geradezu demokratischer Entwicklungen, dadurch zugleich ein Ausdruck von Vielfalt und Diversität“. Daher dürfe man „Sprache nicht zu sehr mit Anliegen aufladen“.
Bildquelle: Pixabay, Bild von Peggy und Marco Lachmann-Anke, Pixabay License

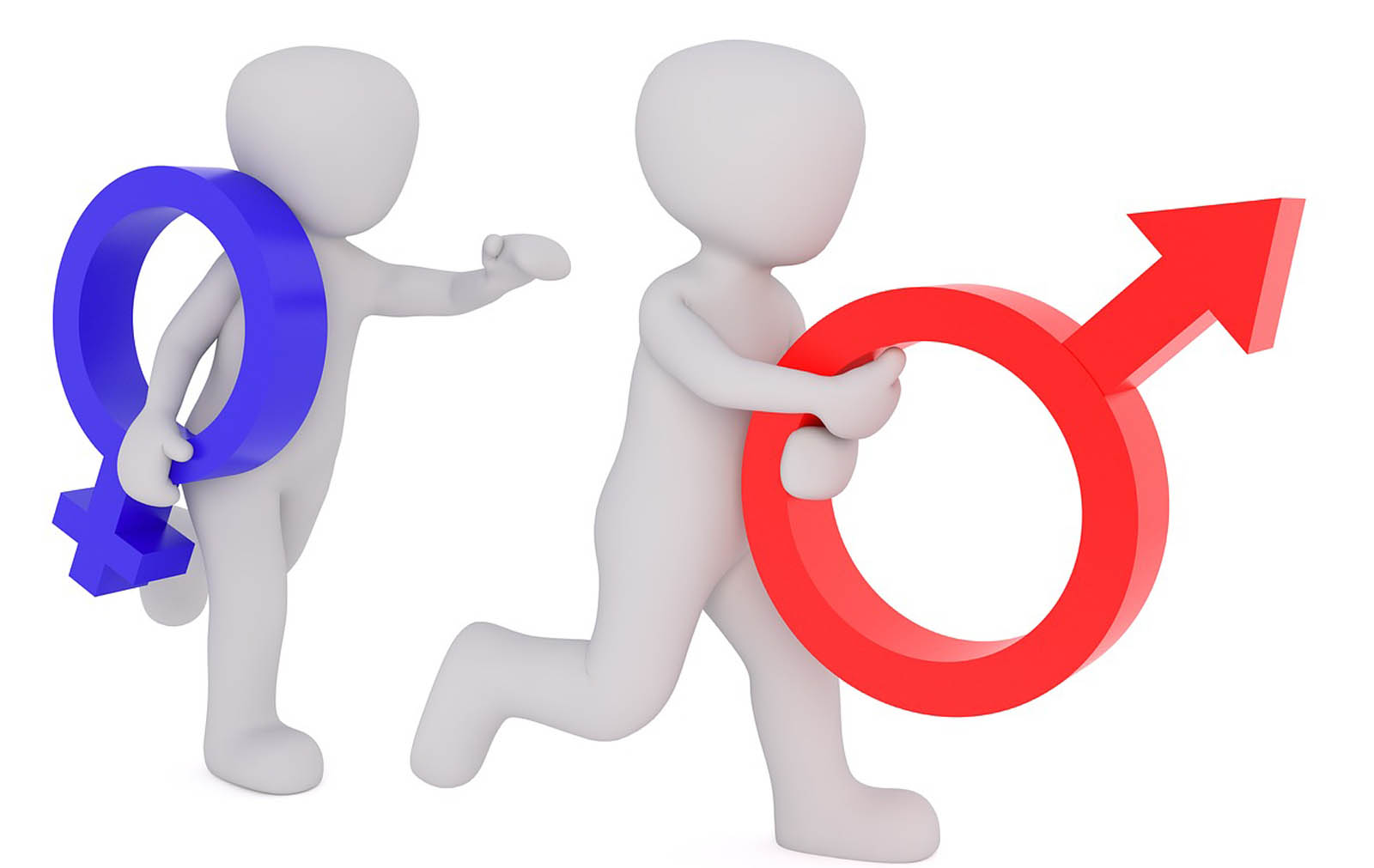














 Unser Blog lebt durch Sie!
Unser Blog lebt durch Sie!