Unter der Überschrift „Ein Gericht, das sich mit Vermutungen zufriedengibt“ gab es neulich einen Kommentar auf sz.de, der nicht unwidersprochen bleiben kann. Gegenstand des Kommentars ist eine Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten. Es geht um die Attacke auf einen jüdischen Studenten in Berlin. Der Fall erregte großes Aufsehen, die Entscheidung des Gerichts ebenfalls.
Hier soll es weder um Falldetails noch um die Entscheidung des Gerichts gehen, sondern um den Kommentar. Der Kommentator übt Urteilskritik. Dazu muss man sagen: Urteilskritik kann vielfältig sein: milde, hart, skandalös, opferfreundlich – um nur einige Beispiele zu nennen. Gegen Urteilskritik ist grundsätzlich nichts einzuwenden, denn Urteile werden im Namen des Volkes gesprochen. Sie sind somit nicht nur Allgemeingut, sondern können auch kritisiert werden. Mehr noch: Gerade bei strafgerichtlichen Urteilen ist es gut und richtig, wenn man sie mit kritischem Blick zur Kenntnis nimmt, schließlich geht es um das sogenannte schärfste Schwert des Staates.
Der hier zu besprechende Kommentar fällt also nicht allein dadurch auf, dass er kritisch ist. Es geht vielmehr um seinen Inhalt. Der Kommentator übt nicht einfach nur Kritik, sondern er wird kurzerhand selbst zur Rechtsmittelinstanz und beginnt eine pseudo-juristische Fehlersuche, die sich vor allem durch eingeschränkte Fall- sowie die weitgehende Unkenntnis strafprozessualer Spielregeln auszeichnet. Das ist nicht untypisch und ein guter Anlass, erneut auf Probleme bei der medialen Urteilskritik hinzuweisen. Denn einerseits wird die Presse als „watch dog“ beziehungsweise vierte Gewalt im Rechtsstaat geschätzt und gebraucht. Andererseits könnten Menschen, die solche Kommentare lesen, ein falsches Bild von der Arbeit der Justiz gewinnen, gar das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren.
Zunächst sollte man die schriftlichen Urteilsgründe abwarten. Denn sie sind – im wahren Wortsinne – entscheidend. Wer nicht so lange warten will, muss zumindest anerkennen, dass ohne sie die abschließende Bewertung eines Urteils kaum sinnvoll möglich ist. Denn anders als das Gericht kennen Außenstehende den Akteninhalt nicht und haben nur selten die Hauptverhandlung vollständig mitverfolgt. So bleibt ihnen als Bezugspunkt oftmals nur die mündliche Urteilsbegründung, die jedoch notwendigerweise defizitär ist. Das wird nicht nur jede Strafverteidigerin und jeder Strafverteidiger bestätigen (lesenswert: Kuhlmann, HRRS 2014, 25), sondern ergibt sich auch aus dem Gesetz. Nach Paragraf 268 Absatz 2 Satz 2 Strafprozessordnung besteht keine Vollständigkeitsgarantie, sondern es geht allein um den „wesentlichen Inhalt“. Noch dazu hat der Bundesgerichtshof (NJW 1961, 419, 420) klargestellt, dass es für den Urteilsspruch ausschließlich auf die schriftlichen Urteilsgründe ankomme; „[i]hnen gegenüber ist die mündliche Begründung ohne Bedeutung“.
Problematisch wird es, wenn auf der schwachen Grundlage der mündlichen Urteilsbegründung die Beweiswürdigung angegriffen wird. Dabei ist Beweiswürdigung, so sagt es der Bundesgerichtshof (HRRS 2017 Nr. 64), „Sache des Tatrichters“. Wenn man aber als Außenstehender ohne ausreichende Fall- und Sachkenntnis hingeht und die tatrichterliche Beweiswürdigung kurzerhand durch seine eigene (gemeint ist: die richtige) ersetzt, dann klingt das hier etwa wie folgt: „Richter mussten sich auf Indizien stützen“, „konnte das Gericht nur vermuten“, „[n]atürlich ist nicht auszuschließen, dass“. Das ist überheblich und geht in der Regel schief. In diesem Fall gilt das umso mehr, als der Kommentator offensichtlich nicht verstanden hat, worauf es entscheidend ankommt, nämlich auf die richterliche Überzeugung (Paragraf 261 Strafprozessordnung). Auch gibt es gerade keine Beweisregel dahingehend, dass das Gericht die Einlassung eines Angeklagten widerlegen muss; es kann sich auch schlicht um Schutzbehauptungen handeln.
Das soll jetzt nicht defätistisch klingen, aber am Ende blickt man auf den Kommentar und fragt sich: Worum geht es dem Kommentator eigentlich? Will er dem Gericht wirklich Fehler nachweisen oder bereitet er nur seinen Wechsel in die Sportredaktion vor? Man muss sich wohl mit Vermutungen zufriedengeben.
Bildquelle: Pixabay

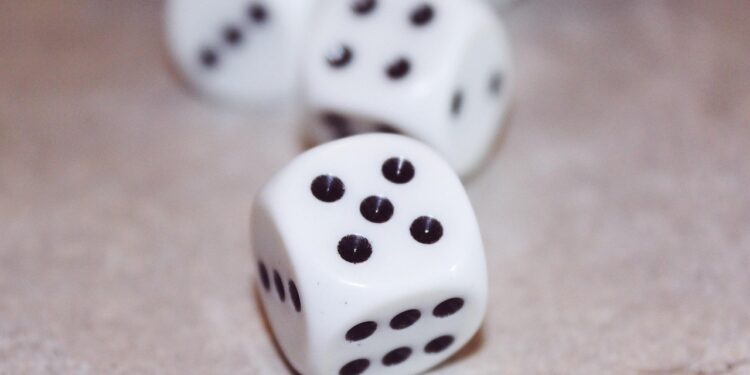














 Unser Blog lebt durch Sie!
Unser Blog lebt durch Sie!