Es ist eine sehr allgemeine Beobachtung, dass Zumutungen sehr viel unkritischer auf- genommen werden, wenn sie sich scheinbar von selbst ergeben, als wenn sie politisch transparent entschieden werden. Gerade solche Probleme wie die Finanzierung angemessener Renten tun sich daher leichter mit Systemen wie den schwedischen Aktienfonds als mit dem deutschen „Generationenvertrag“ zwischen jungen Beitragszahlern und alten Rentnern. Denn in diesem System sind die Folgen einer demographischen Alterung per- fekt transparent: die gesetzliche Rente kann nur auf einem passablen Niveau gehalten werden, wenn einerseits die Beitragszahler (die „Aktiven“) höhere Abzüge hinnehmen und anderseits die arbeitgebenden Unternehmen, Behörden etc. ebenfalls höhere Bei- träge an die Rentenanstalt abführen. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Unternehmensbeiträge indirekt die Einkommensspielräume der Aktiven entsprechend verkleinern, so dass man sagen kann:
Was den Rentnern ausgezahlt wird, haben die Aktiven aufzubringen.
Diese Logik der gesetzlichen Rente in Deutschland ist nun politisch unangenehm, weil steigende Abzüge auf dem Gehaltszettel Unzufriedenheit erzeugen – möglicherweise auch das Wahlverhalten zugunsten solcher Kräfte verschieben, die diese Logik mit in- transparenten Versprechungen verschleiern.
Deshalb muss man sich solche Konzepte anschauen.
Ein trivialer Weg zu höheren Alterseinkommen ohne Erhöhung der Lohnabzüge ist, selbst Erspartes und die Zinsen im Alter zusätzlich zu verbrauchen. Auch dies ist allerdings eine Entnahme aus der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung, die diese Wertschöpfung ja nicht größer macht, also unmerklich den Aktiven nicht zur Verfügung steht. „Unmerklich“ bedeutet, dass es unmöglich (1) scheint, die Wirkungskette nachzuzeichnen, in der dieser Vermögenskonsum der Rentner den Lohn- und Konsumspielraum der Aktiven kompensatorisch einengt. Diese Logik ist beinahe zwingend – beinahe, weil die volkswirtschaftliche Wirkung einer zusätzlichen Spartätigkeit kaum nachzuzeichnen ist, zumal es generell keine Kapitalknappheit gibt und Deutschland bereits eine sehr hohe Sparrate privater Haushalte aufweist (2).
Man kann den Rentnern auch überproportional mehr zukommen lassen, indem man die betriebliche Zusatzversorgung ausbaut oder die Beamten einbezieht; auf den 2. Blick merkt man aber, dass im ersten Fall die Lohnspielräume entsprechend kleiner werden, es also den Aktiven doch entzogen wird – man kann sich auch einbilden, Unternehmens- gewinne oder Dividenden seien eine für die Aktiven harmlose Geldquelle für den wach- senden Rentnerberg. Dass solche Vorstellungen gerade bei „Linken“ populär sind, überrascht, wo sie doch sonst so scharfsinnige Analysen über die Machtverhältnisse in der globalisierten Marktwirtschaft vortragen – ich jedenfalls teile diese Sicht, dass Unter- nehmen und Aktionäre die Gewinnziele entsprechend erhöhen, also ebenfalls die Lohnspielräume der Aktiven verkürzen würden.
Wenn die Beamten wie die Angestellten im Öffentlichen Dienst samt der dabei üblichen Zusatzversorgung bezahlt würden, lieferte die erhoffte Schlechterstellung der Beamten wahrscheinlich einen kleinen Gewinn für die Allgemeinheit; es wäre eine interne Umverteilung in der Gruppe der „Rentner“, wie man sie natürlich auch zulasten anderer Bezieher höherer Renten fordern kann. Eine spürbare Entlastung der demographischen Rentenproblematik ist davon nicht zu erwarten! So kann man auch anderen Mitbürgern etwas wegnehmen, etwa den Millionäre und Spitzenverdienern oder den Bürgergeldbeziehern und diesen Gewinn auf den Rentnerberg legen. Mit solchen Stellschrauben verändert man ein klein wenig die Situation, aber nicht die Dynamik der Demographie.
In der öffentlichen Rentendebatte wird häufig mit Altersarmut argumentiert, die zu berücksichtigen sei. Richtig! Da wird man sozialpolitische Maßnahmen aus Steuermitteln benötigen, aber bitte auf der Grundlage richtiger Zahlen! Viele statistische Angaben berücksichtigen betriebliche Zusatzversicherungen nicht oder wissen nichts von den Re- gelungen, die als „goldener Handschlag“ bezeichnet werden, also eine Verabschiedung in den Ruhestand mit hoher Einmalzahlung. Und Alte wie ich gelten in manchen Statistiken ungeachtet einer Beamtenpension als arme Kleinrentner, wenn sie eine von der Pension abgezogene Minirente aus früherer Angestelltentätigkeit erhalten.
Sehr ernst zu nehmen ist das schwedische Modell einer Aktienrente. Es ist wahrscheinlich ebenso leistungsfähig wie das richtig weiter entwickelte deutsche System mit dem „Generationenvertrag“. Es zieht den Aktiven den Rentenbeitrag nur auf andere Weise aus der Tasche – zugegebenermaßen so undurchschaubar, dass es sozial weniger Akzeptanzprobleme hat. Deutschland hätte diesen Weg auch beschreiten können – viel- leicht schon zu Bismarcks Zeiten oder nach dem 2. Weltkrieg – hat es aber nicht. Wenn jetzt und in den nächsten Jahren den Lasten des Rentnerbergs noch ein Zwangssparen in Aktienfonds hinzugefügt würde, wäre meines Erachtens realökonomisch nicht nur nichts gewonnen, sondern gerade bei den geringen Einkommen der Stress erhöht. Frei- willig kann ja jeder sparen, wie und womit er will und kann. Man beachte auch Fußnote 1: dass Schweden und Schweiz nur 4%-Punkte höhere Sparrate haben als Deutschland finde ich erstaunlich und Anlass, das deutsche System nicht schlecht zu reden.
Je häufiger ich über die demographische Verschiebung in alternden Gesellschaften nachdenke und diskutiere, desto klarer scheint mir, dass nur 2 Möglichkeiten an der Wurzel des Problems anpacken, weil sie die Zahl der Aktiven gegenüber der der Rentner erhöhen.
Bezüglich des Arbeitskräfte-Imports fehlt in der Öffentlichkeit eine klare Aussage über den Netto-Effekt, denn diese ausländischen Arbeitskräfte brauchen ihrerseits ja auch wieder Wohnungen, Kinder- und Altenbetreuung und Verwaltungsinfrastruktur – ganz abgesehen davon, dass sich in den europäischen Staaten eine Ausländerfeindlichkeit verbreitet hat, die erkennbar die Demokratie selbst gefährdet. Gelingt eine gute Eingliederung vor allem junger Fachkräfte, so kann das die Probleme mit der Rente eine Zeit lang mildern, bis sich ihr generatives Verhalten dem der europäischen Staaten an- passen wird. Die Bevölkerungspyramide dürfte sich so nicht nachhaltig ändern – es sei denn, man unterstellt einen dauerhaften Zuzug aus anderen Ländern und Kulturen und gäbe damit jenen Futter, die von Umvolkung schwadronieren.
Die Bemühungen von Staat und Wirtschaft um Aktivierung nicht arbeitender Mit- bürger sind sicher steigerungsfähig; allerdings ist in Anbetracht einiger Megatrends der globalen Entwicklung (Wettbewerb neuer Marktteilnehmer, Engpässe bei natürlichen Ressourcen) eher damit zu rechnen, dass es in Kernbereichen der deutschen Exportindustrie zu einem Wertschöpfungs- und Beschäftigungsabbau kommen wird. Bei Frauen ist damit zu rechnen, dass mehr qualifizierte Frauen arbeiten wollen – nicht nur in Teilzeit; die Grenzen einer Eltern-Mobilisierung liegen allerdings auch offen: ob man das begrüßt oder kritisiert, mit Kindern ist doppelte Berufstätigkeit der Eltern oft schwer zu realisieren. Eine Betreuung der Kinder außer Haus stößt auf enge Grenzen verfügbaren Betreuungspersonals und ist nicht für jede Familie attraktiv.
Es bleibt also als einzig nachhaltige Maßnahme gegen den auch von den „Wirtschaftsweisen“ prognostizierten Rentenkollaps die allmähliche weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters, gegen die sich so viele in Deutschland wehren, weil sie nicht Franz Müntefering, sondern unverständlicherweise denjenigen glauben, die behaupten, irgendwelche meist unverstandenen Finanzierungsmethoden könnten den Rentnern geben, was den Aktiven nicht genommen werden müsste.
Wir müssen also erkennen und anerkennen, dass die Demographie unseres Landes unser Schicksal ist, dem wir nicht durch alternative Finanzierungen aus dem Weg gehen können.
Anmerkungen
1 Es ist schwer, einem komplizierten Apparat nachzuweisen, dass er kein perpetuum mobile ist, der Energie aus dem Nichts schöpft. Man weiß aber auch ohne Prüfung, dass es das nicht gibt!
2 www.laenderdaten.de/wirtschaft/sparquote.aspx für 2015 27,3%, Schweden und Schweiz nur 4% mehr, USA und GB 9 b.z.w. 15% weniger
Bildquelle: Pixabay














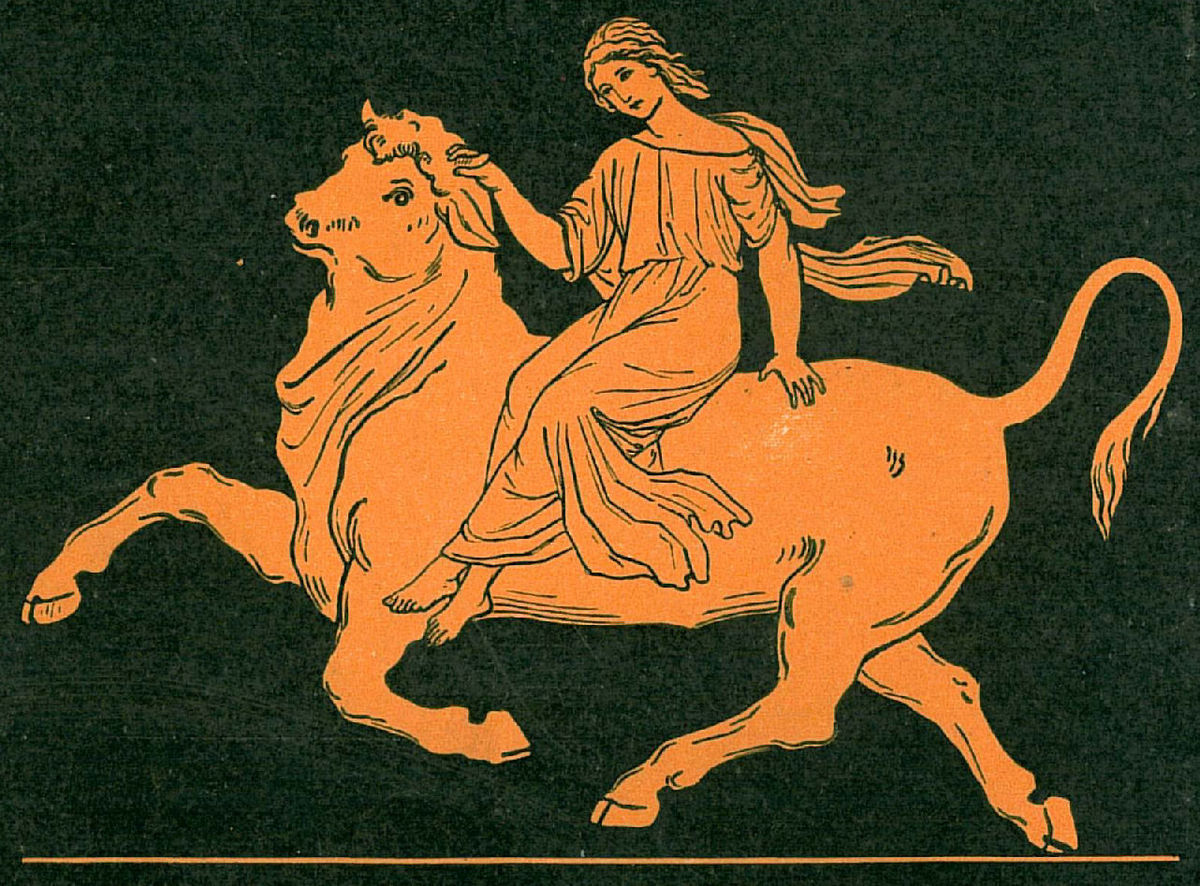

 Unser Blog lebt durch Sie!
Unser Blog lebt durch Sie!