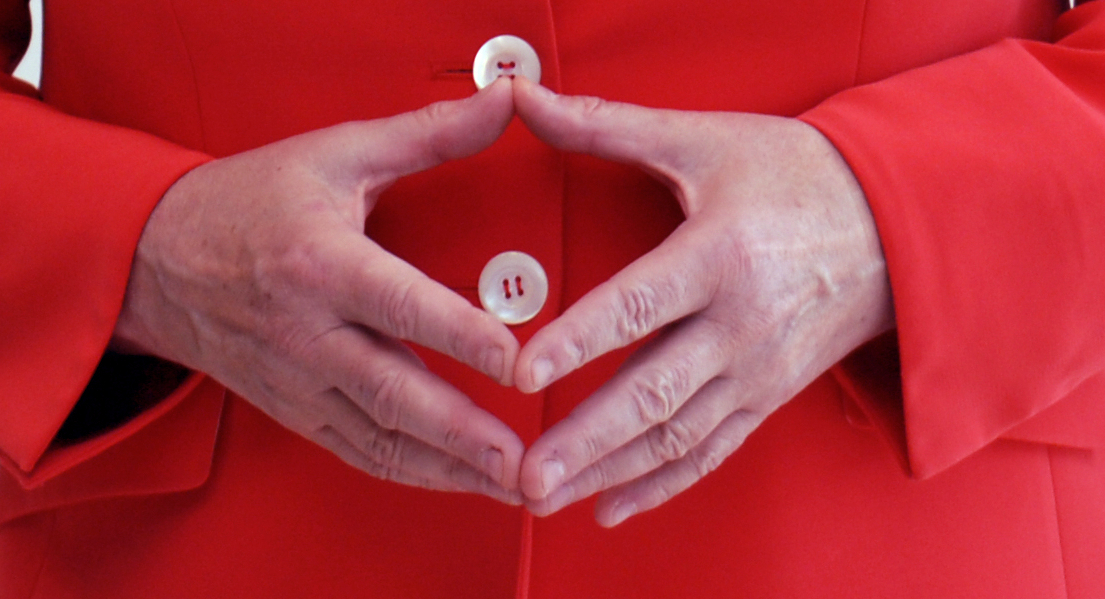Im Feuilleton des Bonner General- Anzeiger lautete dieser Tage eine Überschrift „Zufußgehende und „Zombiejagende“. Die Überschrift stand zu einem Text aus der Feder des Feuilleton-Chefs der Zeitung Dietmar Kanthak. Der berichtete über „sprachlichen Konformitätsdruck“, der sich nun in einer Anleitung der Kölner Stadtverwaltung sowie eines Erlanger Hörbuchverlags niederschlage. Ja, niederschlagen ist das treffende Tätigkeitswort.
„Messerwerfende“ statt Messerwerfer, „Zombiejagende“ statt Zombiejäger beziehen sich auf einen gesprochenen Roman, der sich mit Zombies beschäftigt, die zu solchen geworden sind, nachdem sie einer Seuche zum Opfer gefallen waren. Autor Dinko Skoplak verteidigt seine „Zombiejagenden“ gegen, wie er sagt „Ewiggestrige“, die sich dem fortwährenden sprachlichen Zustand des Zombie-Jagens nicht beugen wollen. Ewiggestrige waren doch die, die braun für eine Weltanschauung hielten, so dachte ich. Aber auch das scheint sich geändert zu haben.
Und die Stadt Köln? Ich folge der Kölnischen Rundschau: „Die Amtssprache der Kölner Stadtverwaltung steht vor ihrer wohl größten Veränderung seit Jahrzehnten. Seit März wird die gesamte Kommunikation der Stadt `geschlechterumfassender, wertschätzender und diskriminierungsfreier` gestaltet. Das Gleichstellungsamt und das Amt für Integration haben dafür einen 56-seitigen Leitfaden verfasst. Darin wird den rund 19 500 Beschäftigen erläutert, wie eine `gendergerechte` Sprache aussieht.“
Ewiggestrig! Größte Veränderung seit Jahrzehnten! Die gesamte Kommunikation der Stadt! Wertschätzender! Geschlechterumfassender! Der Leitfaden scheint ja eine bedeutende Erlösung zu sein – vergleichbar dem berühmten Satz vom 26. Juni 1963: „Ich bin ein Berliner.“
Sprache heißt Sprache, weil sie gesprochen wird. Wäre es anders, hieße die Sprache nicht Sprache sondern eben anders. Liegt eine Betonung auf der lautlosen Sprache, dann spreche ich von Schriftsprache. Gibt es einen Unterschied zwischen Sprache und Schriftsprache? Ja, den gibt es. Den gab es immer.
Muttersprache, Gehörtes, Erlerntes, das ist das, was Mensch irgendwann kann, meist ohne Mühe kann. Die lautlose Sprache jedoch bereitet vielen auch dann noch Mühe, wenn sie die Muttersprache ohne Zögern sprechen. Denken Sie an den über das Blatt kreisenden Füller! Die Zungenspitze, die sich aus den Lippen drängt, das lautlose Buchstabieren, den hilfesuchenden Blick an die Decke. In einer Muttersprache gibt es übrigens keine „Messerwerfende“. Worte wie „blutrünstige Bestien“ für Menschen, die von einer Seuche dahin gerafft wurden, kommen in meiner Muttersprache auch nicht vor. Der Vorgang des Messerwerfens ist rascher vorbei als ein ratsuchender Blick an die Decke dauert.
In der Muttersprache kennzeichnet „der Messerwerfer“ eine Eigenschaft, die einem Menschen und einem abgeschlossenen Vorgang zugeordnet ist. Einem einmaligen oder mehrmaligen Vorgang. Der eine ist Messerwerfer, der andere Organist, der dritte arbeitet auf dem Gaswerk.
Messerwerfende lösen den Bezug zu Person und Zeit auf. Ja, Sprache verliert Sinn, denn der Vorgang des Messerwerfens dauert an. Am Ende der Zeit steht der Messerwerfer neben dem vom Gaswerk vor dem Richter, christlicher Überzeugung nach. Messerwerfende sind dann immer noch zugange.
Gesprochene Sprache legt fest. Sie ist eindeutig, vielfältig und listig. Sprache war ohne Leitfäden immer Vielfalt. Das fängt mit der Muttersprache an. Sie bietet Ausdruckschancen, die ihresgleichen suchen und nicht finden. Böll sprach einmal mit Blick auf Wehners Art des Umgangs mit der Sprache von „lull-Knurren“. Böll ließ diese Laute sich im Mundraum entfalten, er spuckte sie also nicht durch die Lippen aus. So wie Rheinländer Laute im Mund halten. Ist nicht reproduzierbar, lediglich annähernd.
Die Muttersprache der Kinder vom Land und aus weniger betuchten Straßen war so, dass man sie verlernen sollte, nachdem man ihrer sicher war, um zu lernen, wie Mensch auf Bühnen sprach, dies aber – ebenfalls – nur annähernd. Sagen Sie selber, was Ihnen besser gefällt: Der Ton auf der Schule klang etwa so: „Lass das sein! Schluss jetzt!“ Daheim hieß es: „Jung hür endlich op!“ Sie werden das Folgende abstreiten, ich bleibe dennoch auf meiner Ansicht: Zwischen beidem – dem „Schluss jetzt!“ – und dem „Jung hür endlich op“ hängen wir sprachlich lebenslang, fruchtbar, jedenfalls viele von uns.
Grundlage allen Sprechens ist demnach Subjektivität. Den Messerwerfer kannte man. Nimm dich vor dem in Acht! Messerwerfende gab es nicht. Subjektivität ist ebenfalls Grundlage allen Schreibens, welches über städtische „Leitfäden“ hinausgeht. Das zu ändern ist verdammt schwierig. George Orwell hat 1946 den sarkastischen Versuch der Änderung unternommen. In seinem Roman „1984“ kreierte er den „Newspeak“, den „Neusprech“. Hat sich der Menschen, der Demokratie und ihrer Institutionen wegen, Gott sei außerdem gedankt, nicht durchgesetzt. Bei uns jedenfalls nicht.
Damit ist fast alles gesagt. Fast. Nur noch ein kurzer Blick zurück.
Es gibt eben Unterschiede zu früher und noch früher: Früher haben „Beauftragte“ der „Obrigkeit“ sowohl Amts- wie Umgangs-Schriftsprache beeinflusst beziehungsweise geprägt. So entstanden der “Blockwart“, der „Gefolgsmann“, der „Arierparagraph“, der Käse „halbfett“, der „Jahresendbaum“ und anderes mehr. Bis auf „halbfett“ und „Gefolgsmann“ ist so ziemlich alles wieder weg.
Der Ton gibt Herrschaft oder Zuwendung an; verstehen, missbilligen oder ablehnen. Schriftsprache hat erst dann einen Ton, wenn sie in unserem Kopf wieder Sprache geworden ist. Sonst bleibt sie stumm. Das Wissen setzte die Symbole, Wissen war von Herkunft und Bildungsmöglichkeit abhängig. Erst nach und nach haben sich die Unterprivilegierten die Schriftsprache zu ihrer Sprache gemacht, zum Beispiel zur Sprache in der Lutherbibel. Die Reste des beschriebenen Zustandes können wir im Geschlechts-bezogenen Schriftsprach-Gebrauch besichtigen. Das ist wahr und heutzutage ärgerlich. Ebenso wahr ist, dass die Menschen allesamt ihren Sprachplatz benötigen.
So gesehen ist unsere Sprache zwar eindeutig und vielfältig, listig, subjektiv und nicht fertig, aber auch hilflos. Der Lehrsatz: Schriftsprache ist so aufzuschreiben, dass sie sich sprechen lässt, hat Gültigkeit verloren. Sehe ich zwei Punkte übereinander gesetzt, aufgeschrieben, identifiziere ich deren Funktion. Es ist ein Satzmittezeichen, das die Funktion hat, das folgend Geschriebene abzutrennen und zu betonen. Sehe ich dieses Zeichen, sage ich: Doppelpunkt.
Vorbei. Der Doppelpunkt heißt Doppelpunkt, meint aber „und“ oder „oder“. Das Sternchen zwischen zwei Worten ist nicht mal Satzzeichen, sondern lediglich Schriftzeichen. Sprechen soll es sich dennoch lassen. Unter scribar.de fand ich folgenden bemerkenswerten Satz: „Gerade durch die bessere Barrierefreiheit gegenüber Sternchen und anderen Sonderzeichen ist zu erwarten, dass der Doppelpunkt in Zukunft vermehrt eingesetzt wird.“
Der Deutsche Blinden- uns Sehbehinderten Verband (DBSV) hält das Gendern mit Stern und Doppelpunkt für „problematisch“: Mitarbeiter_innen, Mitarbeiter/-innen, MitarbeiterInnen, Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter:innen seien „nicht zu empfehlen“. Von wegen besserer Barrierefreiheit.
Die Sprache kann sich nicht wehren, sie ist hilflos. Aber vielleicht geschieht ja ein Wunder und die Sternchen kommen wieder dorthin, wo sie schriftsprache-mäßig einmal waren, in den Himmel: „Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel, und waren lauter blanke Taler…“