Privat vor Staat auch im Bildungsbereich
Friedrich Merz käme nie auf die Idee, wie der ehemalige Vizekanzler Franz Müntefering mit seiner Volksschulzeit im Sauerland zu kokettieren. Denn er ist ein ausgesprochener Fan privater Bildungseinrichtungen, Schulen und Hochschulen. Um „zu einer dauerhaft tragfähigen finanziellen Ausstattung von Schulen und Hochschulen“ zu gelangen, schlägt Merz deren „Öffnung für privates Kapital“ statt einer merklichen Erhöhung der Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden vor: „Ich plädiere keineswegs dafür, staatliche Schulen und Universitäten zu Profit-Centern umzufunktionieren. Doch sie könnten sich insgesamt viel stärker für Spenden und Stiftungen öffnen, als sie es bislang getan haben.“ (S. 182)
Als ob der Einfluss der Wirtschaft auf die Schulen und Hochschulen des Landes nicht längst viel zu groß wäre! Merz preist ausgerechnet die von der Stiftung eines Hamburger Logistikunternehmers mit Schweizer Wohnsitz getragene „Kühne School of Logistics and Management“ und die mit riesigen Geldbeträgen vom Bremer Senat bezuschusste, alsbald nach der ebenfalls in die Schweiz gezogenen Kaffeeröster-Familie in „Jacobs University“ umbenannte, später weiterverkaufte und heute „Constructor University“ heißende „International University Bremen“ als „gute Vorbilder“ (S. 184) für die Umstrukturierung der hiesigen Bildungslandschaft.
Zwar behauptet Merz vollmundig: „Noch nie war die grundsätzliche Bereitschaft der Unternehmen und der vermögenden Privatpersonen, für die Bildung in Deutschland Geld zur Verfügung zu stellen, größer als gegenwärtig.“ (S. 185) Stark ausgeprägt und uneigennützig scheint diese Bereitschaft aber nicht zu sein, denn Merz räumt ein, dass sich der „Aufbau eines Vermögensstocks bei den Universitäten“ keineswegs „über die Spenden und Stiftungen aus dem versteuerten Einkommen“ realisieren lasse: „Zumindest der steuerlich sofort abzugsfähige Höchstbetrag muss bei der Gründung von Stiftungen auf mindestens eine Million Euro im Jahr angehoben werden, sonst wird nicht genügend Geld aus privaten Quellen zusammenkommen.“ (S. 186)
Ginge es nach Merz, würde das Volk der Dichter und Denker perspektivisch zum Volk der Stifter und Schenker, während der Staat noch weniger Steuern von Hochvermögenden und Spitzenverdienern fordern würde, damit diese mit dem sonst dem Fiskus zufließenden Geld einen umso stärkeren Einfluss auf die Bildungseinrichtungen nehmen könnten.
Darüber hinaus fordert Merz, dass wohlhabende Eltern die teilweise horrenden Schulgebühren ihrer Sprösslinge an Privatschulen von der Einkommensteuer absetzen können sollten. Andernfalls sieht er „die Loyalität der Leistungseliten zu unserem Staat und unserer Gesellschaft“ in Gefahr: „Die ‚Besserverdienenden‘ haben genügend Möglichkeiten, schon bei der Ausbildung ihrer Kinder dem Standort Deutschland auszuweichen. Seit Jahren steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die im Ausland auf Privatschulen gehen, ebenso drastisch an wie die Zahl der dauerhaft im Ausland studierenden deutschen Studenten.“ (S. 180)
Man kann darin eine versteckte Drohung und den Versuch einer politischen Nötigung sehen, dass Merz einen Kausalzusammenhang zwischen Steuergeschenken an Reiche und der „Standorttreue“ ihrer Kinder herstellt. Rechtspopulistisch ist, dass Merz seine Vorstöße zugunsten ohnehin materiell Privilegierter grundsätzlich als Initiativen zugunsten Unterprivilegierter, von ihm durchgängig als „sozial Schwache“ bezeichnet, auszugeben sucht – so auch in diesem Fall: „Fehlende Loyalität und mangelnde Bereitschaft zum privaten Engagement gehen schlussendlich vor allem zulasten der sozial schwächeren Kinder, die auf gute staatliche Bildungseinrichtungen am meisten angewiesen sind.“ (ebd.)
Finanzmarktkapitalismus pur
Friedrich Merz leugnet nicht, dass es in Deutschland ein „Einkommens- und Vermögensproblem“ gibt, wie er die bestehende Verteilungsschieflage reichlich nebulös bezeichnet, glaubt jedoch allen Ernstes, es durch eine größere individuelle Sparbereitschaft, den Konsumverzicht der Bevölkerungsmehrheit zugunsten eines langfristigen Vermögensaufbaus und die Kapitalbildung in Arbeitnehmerhand mittels ETF-Sparplänen lösen zu können (siehe S. 127). Die abhängig Beschäftigten will Merz zu (Klein-)Aktionären machen und eine „Kultur der Aktie“ etablieren. Ausführlich behandelt er in seinem Buch die (Teil-)Privatisierung der Volkswagen AG und der Telekom AG – bis heute ein Trauma für Millionen Kleinaktionäre, die ihre Hoffnung auf mühelosen Reichtum mit dem Verlust ihrer Ersparnisse bezahlten. Trotzdem möchte Merz die Bevölkerung durch einen „Überzeugungsprozess, der Aufklärungs- und Vertrauensarbeit erfordert“ (S. 90), für den Kapitalmarkt zurückgewinnen.
Seitenlang schwärmt Merz von der „Leistungsfähigkeit kapitalmarktorientierter Modelle der Vermögensbildung“ (S. 148) und listet detailliert hohe Erträge, Vermögen und Auszahlungen verschiedener US-Pensionsfonds auf. Wie ein aufdringlicher Börsenmakler preist Merz sog. Exchange Traded Funds, etwa Dax-Indexzertifikate, mit dem zweifelhaften Argument an, dass sie regelmäßig deutlich höhere Renditen als Pflichtbeiträge in die Gesetzliche Rentenversicherung erzielten (vgl. S. 90 f.). Merz vergleicht hier Äpfel mit Birnen, nämlich ein kollektives Solidarsystem, das sich seit weit über 100 Jahren bewährt sowie zwei Weltkriege, Krisen und Inflationen überdauert hat, wegen seines Umlageverfahrens aber gar keine Dividenden kennt, mit einem individuellen Lotteriespiel, das neben Gewinnern zwangsläufig auch Verlierer/innen hervorbringt.
Auch bricht Merz eine Lanze für Finanzinvestoren, die man nicht als „Heuschrecken“ verunglimpfen dürfe, weil sie angeschlagene und in Schieflage geratene Firmen häufig wieder wettbewerbsfähig machten: „Ohne Finanzinvestoren ginge es vielen Unternehmen schlechter, und viele Beschäftigte, die heute einen sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz haben, wären arbeitslos.“ (S. 111)
Merz hat kein christliches, sondern ein ausgesprochen elitäres Menschenbild: Im unteren Teil der Gesellschaft sind die Menschen seiner Einschätzung nach überwiegend faul, denn sie „neigen in ihrer großen Mehrheit zur Bequemlichkeit“ (S. 57) und nehmen in „größerer Zahl“ die Leistungen der Arbeitslosenversicherung „auch ganz gern einmal in Anspruch“ (S. 172); im oberen Teil der Gesellschaft ist hingegen das „Macht- und Gewinnstreben“ völlig normal, weil „Teil der menschlichen Natur“, wie Merz schreibt (siehe S. 119). Daraus resultiert bei ihm die Verachtung von Leistungsbeziehern einerseits und die Verherrlichung von hauptsächlich in den Familienunternehmen lokalisierten „Leistungsträgern“ andererseits: „Im eigentümergeführten Mittelstand gibt es nach wie vor ein über Generationen hinweg gelebtes vorbildliches Führungsverhalten, das geprägt ist von der Verantwortung für das Unternehmen und seine Mitarbeiter sowie von der beständigen Sorge um die Fortführung des Unternehmens auch in der nächsten Generation.“ (S. 120 f.) Millionengehälter von Topmanagern sind Merz zufolge „als Anerkennung für die unternehmerische Leistung“ (S. 123) gerechtfertigt. Fehlverhalten und Gier bei Unternehmern oder Managern wertet Merz als „kritikwürdige Einzelfälle“ (S. 124), beim ebenfalls seltenen „Sozialmissbrauch“ von Transferleistungsbeziehern geht er davon aber mitnichten aus.
Friedrich Merz – neoliberal, unsozial, scheißegal?
Aufgrund seines elitären Bewusstseins schert sich Merz nicht groß um die Demokratie, wenn es gilt, eigene Vorstellungen durchzusetzen. Vielmehr sieht er den Erfolg politischer Führung und Verantwortung gerade darin, Entscheidungen auch gegen die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung durchzusetzen. „Wenigstens zeitversetzt“ müsse es allerdings wieder einen Grundkonsens zwischen Regierung und Bevölkerung geben (siehe S. 52).
Beseelt von neoliberalem Wettbewerbswahn und einem ausgeprägten Standortnationalismus, möchte Merz das angeblich eher schwächelnde Deutschland zu einem exzellenten Wirtschaftsstandort machen und weiter voran bringen: „Wenn wir den Wettbewerb um die besten Köpfe, die besten Produkte, die besten Dienstleistungen, das beste Rechtssystem und die beste Infrastruktur annehmen und unsere Bevölkerung darauf vorbereiten, dass wir uns alle wieder ein wenig mehr anstrengen müssen und nicht weniger, auch im Durchschnitt wieder mehr arbeiten müssen, dann waren die Chancen für uns noch nie so groß wie heute.“ (S. 62) Heute versprechen die Unionsparteien in ihrem Bundestagswahlprogramm, „Deutschland wieder nach vorne“ zu bringen, und zwar exakt mit denselben fragwürdigen Rezepten, die Merz schon damals empfahl.
Alle zentralen Aussagen des Buches von Merz tauchen heute im Wahlprogramm der Union als Kernforderungen wieder auf. Das gilt für die Parole „Mehr Netto vom Brutto!“ (S. 81) genauso wie für die „Technologieoffenheit“ im Hinblick auf die Kernenergie (vgl. S. 93) oder den Anspruch, dass „wir Deutschen“ in technologischer wie ökonomischer Beziehung auch künftig oder wieder „zur Spitzengruppe“ auf der Welt gehören sollten (siehe S. 97).
Warum ein Multimillionär von Millionen Normal- und Geringverdiener(inne)n per Stimmabgabe für dessen Partei unterstützt wird, der aus seiner tiefen Verachtung für solche Menschen, die er nicht wie sich selbst für „Leistungsträger“ hält, keinen Hehl macht, bleibt ein Rätsel. Man ist mit einem Paradox der repräsentativen Demokratie konfrontiert, das auch schon im Falle Jörg Haiders (FPÖ), Silvio Berlusconis (Forza Italia) und Donald Trumps zum Tragen kam. Eine sozialpsychologische Erklärung bietet höchstens die Bewunderung für einen prominenten „Erfolgsmenschen“, dem man folgt, um sich in seinem Glanz sonnen zu können. Auch trägt die verständliche Enttäuschung über Regierungen dazu bei, deren Mitglieder sich für „normale Leute“, sozial Benachteiligte und Unterprivilegierte einzusetzen versprochen hatten, es aber nicht taten.
Prof. Dr. Christoph Butterwegge hat von 1998 bis 2016 Politikwissenschaft an der Universität zu Köln gelehrt und zuletzt die Bücher „Deutschland im Krisenmodus“ sowie „Umverteilung des Reichtums“ veröffentlicht.
Bildquelle: Pixabay

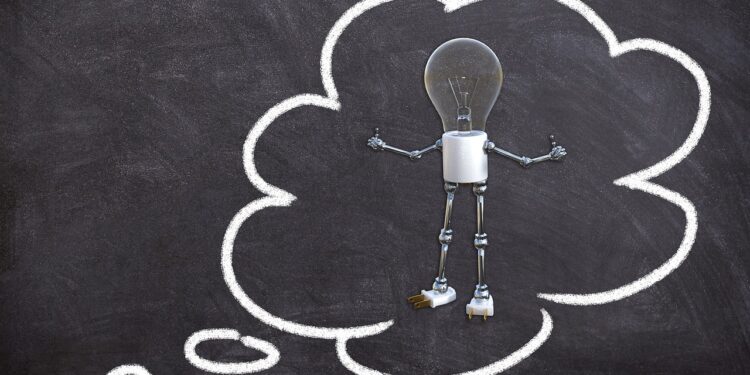














 Unser Blog lebt durch Sie!
Unser Blog lebt durch Sie!