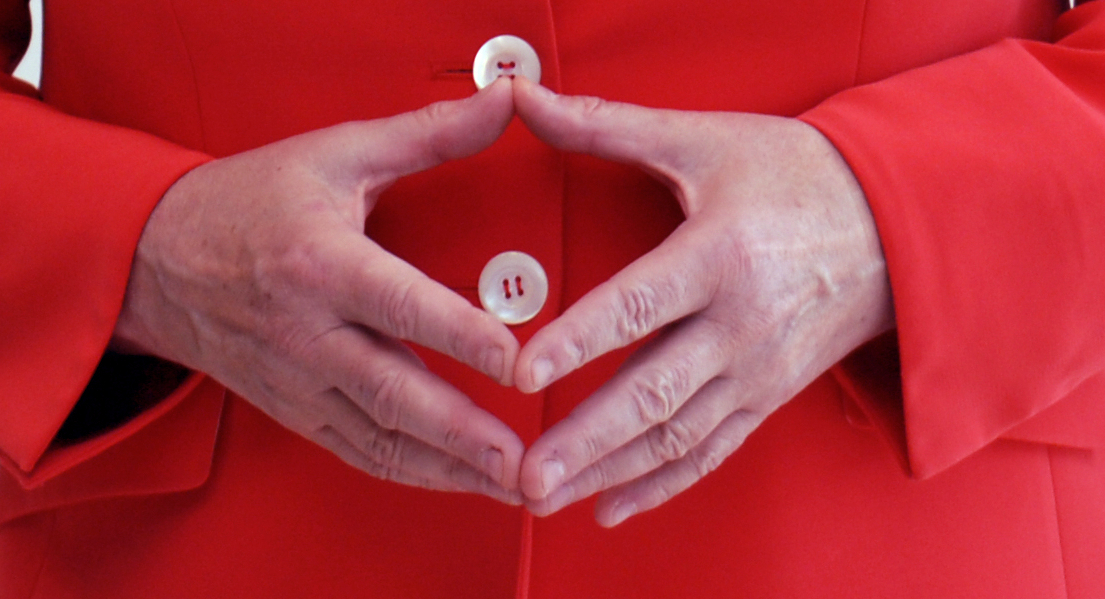Der aktuelle Demokratie-Index des „Economist“ weist für die 167 Länder mit demokratischen Regierungssystemen einen so niedrigen Wert auf wie noch nie seit 2006. Insgesamt sei die Demokratie weltweit im zweiten Jahr hintereinander auf dem Rückzug, heißt es da. Kommen Sie bei Ihrem Forschungsprojekt zu einem ähnlichen Ergebnis?
Michael Zürn: Ja. Wir verzeichnen seit 15 Jahren einen Rückgang der demokratischen Qualität im Gesamtaggregat der demokratisch verfassten Staaten. Zum einen sind von dieser Verschlechterung die Länder betroffen, in denen sich autoritäre Populisten durchgesetzt haben. Hier finden zwar formal Wahlen statt, doch genügen diese nicht demokratischen Qualitätsanforderungen. Zu diesen Ländern zählen die Türkei, Polen, Ungarn, auch Brasilien, Indien, Russland. Hinzu kommt das Aufblühen technokratischer Autokratien wie China.
Donald Trumps Chancen, wiedergewählt zu werden, wären ohne Corona-Krise sicher größer gewesen, aber das schlechte Krisenmanagement hat ihm als Populisten geschadet. Zeigt das nicht, wie resistent die Demokratie am Ende doch ist?
Die Demokratien haben, mindestens in der ersten Welle der Pandemie, besser reagiert als die autoritären Populisten etwa in den USA oder Brasilien. Das ist kein Zufall. Populisten sind allergisch gegenüber unabhängigen Expertinnen, Wissenschaftlern und Qualitätsmedien. Die akzeptieren Populisten nur, wenn sie auf ihrer Seite stehen. Demgegenüber haben die liberalen Demokratien diese Herausforderung besser bewältigt.
Aber?
Dieser Vorteil der Demokratien könnte sich als vorübergehend erweisen. Wenn die Pandemie erfolgreich zurückgedrängt sein sollte und die Staaten wegen der enormen Ausgaben für die Bekämpfung der Corona-Krise stark verschuldet sind, wird es zu einschneidenden Sparmaßnahmen und damit auch wieder zu mehr Ungleichheit und geringeren politischen Handlungsspielräumen kommen. Das sind Bedingungen, von denen Populisten profitieren.
Die Bilanz liberaler Demokratien in Europa bei der Pandemiebekämpfung fällt im Vergleich zu den asiatischen Ländern wie Taiwan, Singapur oder Vietnam nicht gut aus. Was haben die besser gemacht als wir?
Diese Staaten sind weiter in der Digitalisierung. Deswegen konnten wir die Zeit rückläufiger Infektionsraten im Sommer 2020 nicht nutzen, um die Gesundheitsämter technisch ausreichend auszustatten. Versäumt wurde es auch, die Schulen im Sommer digital aufzurüsten.
Und der Datenschutz, der in Asien anders gewichtet wird als hierzulande?
Mein Eindruck ist, dass wir in der Frage des digitalen Datenschutzes einem halbierten Liberalismus anhängen: nur kein starker Staat! Die liberale Lehre geht aber anders: Wir brauchen einen starken Staat, der in der Lage ist, das Gemeinwohl zu befördern. Damit der Staat nicht zu stark wird, muss es jedoch Mechanismen und Instrumente der Kontrolle von Machtmissbrauch geben. Bei der Digitalisierung aber scheint unsere Reaktion zu sein: Oh Gott, der Staat soll auf keinen Fall digitale Kompetenzen haben. Stattdessen sollten wir ihn stark zu machen, um all die privaten Giganten, die ihre digitale Macht aufbauen und denen wir sorglos unsere Daten ausliefern, einhegen zu können. Gleichzeitig muss dann freilich die Kompetenz zur Kontrolle aufgebaut werden. Wir brauchen also einen digital kompetenten Staat und sehr effektive Kontrollmechanismen,.
Seit über einem Jahr kommt es bei uns immer wieder zu tiefen Einschnitten in Bürgerrechte, meist erst nachträglich gebilligt von den Parlamenten. Die Exekutive von Bund und Ländern, beraten von externen Experten, bestimmt über Kontaktbeschränkungen und Schließungen. Wie lange geht das gut?
Die Stunde der Exekutive schlägt ja nicht zum ersten Mal, sondern schon zum dritten Mal in kurzer Zeit – nach der Finanzkrise und der sogenannten Migrationskrise. Immer war die Stunde der Exekutive auch die Stunde der Expertinnen und Experten und der nicht-majoritären Institutionen. In der Krise wurden die Parlamente zugunsten der Draghis und Drostens entmachtet, die zwar für Sachkompetenz stehen, aber nicht für Parteien und Parlamente, die für Entscheidungen Mehrheiten benötigen. Dadurch erlitten Parteien und Parlamente einen beträchtlichen Bedeutungsverlust zugunsten von nationalen und internationalen Nichtmehrheitsinstitutionen wie der Brüsseler EU-Kommission, den Zentralbanken oder Verfassungsgerichten. Diesen langfristigen Trend in unserer Demokratie haben die Krisen sichtbar gemacht.
Die EU hat beim Krisenmanagement gegen die Pandemie keine gute Figur abgegeben. Ist der Nationalstaat, dessen Ende schon eingeläutet schien, doch effektiver als supranationale Organisationen wie EU, WHO, UN? Lockdown, Impfkampagnen, Grenzschließungen – darüber entscheiden die Nationalstaaten allein. Macht Ihnen das Sorgen?
Ja, weil die Verlagerung von Entscheidungen auf die europäische oder internationale Ebene in vielen Bereichen einfach notwendig und wünschenswert ist – beim Klimawandel und dem Datenschutz, bei der Regulierung der Finanzmärkte, der Besteuerung der Digitalkonzerne, der Bekämpfung der globalen Armut.
Deutschland steht am Beginn eines Superwahljahres mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl. Welche Folgen haben die Beschränkungen dieser Zeit auf den Wahlkampf und den Ausgang der Wahl? Sollte das Thema Pandemie aus dem Parteienstreit herausgehalten werden?
Wahlkämpfe sind dazu da, Debatten auszutragen, und dazu gehört auch eine Auseinandersetzung über die verschiedenen Strategien der Parteien in der Corona-Krise. So wird die AfD nicht darauf verzichten, dieses Thema zum Wahlkampfschlager zu machen, um einen Teil der Corona-Leugner für sich zu mobilisieren. Da wäre es für die anderen Parteien besser, offen dagegen zu halten, als das Thema vom Tisch zu nehmen.
Zwei Landtagswahlen im Süden läuten das Superwahljahr ein. In Baden-Württemberg stellt sich die Frage, ob der Grüne Ministerpräsident Kretschmann eine Koalition ohne die CDU bilden kann. In Rheinland-Pfalz könnte SPD-Landeschefin Dreyer von der CDU abgelöst werden. Welche Signalwirkungen können von diesen ersten Stimmungstests ausgehen, insbesondere auf die Bundestagswahl?
Im Südwesten stellt sich die Frage, mit wie viel Selbstvertrauen die Grünen in das Wahljahr gehen. In der Partei herrscht das Grundgefühl, dass man die guten Umfragewerte bisher noch nicht in tolle Wahlergebnisse ummünzen konnten. Wenn sie jetzt zum dritten Mal hintereinander in Baden-Württemberg die Wahl gewinnen können, gibt das Aufwind für den Bund. In der SPD gibt es umgekehrt die Gefahr einer Depression. Wenn das Wahljahr mit einer Abwahl von Frau Dreyer – eine ihrer erfolgreichsten Persönlichkeiten, die ein Stammland regiert – beginnt, könnte das eine negative Dynamik auslösen.
Man kann schon länger auf Länderebene beobachten, dass der Amtsinhaberbonus sehr groß ist. Es ist für die Opposition schwer, einen etablierten Ministerpräsidenten zu stürzen. Ist das ein Problem für die Demokratie?
Das ist kein völlig irrationales Verhalten der Wählerinnen und Wähler. Die Differenz zwischen den Parteien ist in der Wahrnehmung vieler so klein geworden, dass das Wahlprogramm an Bedeutung für die Wahlentscheidung verloren hat. Dafür nimmt die Bedeutung der Charaktereigenschaften der Spitzenkandidaten zu. Hier liegt allerdings ein erhebliches Enttäuschungspotenzial.
Manchen gelingt es allerdings ganz gut, nicht in diese Falle zu tappen.
Richtig. Hier sind beispielsweise Winfried Kretschmann und Angela Merkel zu nennen, beide mit stabil sehr hohen Beliebtheitswerten. Ich halte es für eine enorme politische Leistung, diese Charaktererwartung langfristig nicht enttäuscht zu haben, weil sie skandalfrei geblieben und nicht dem Rausch der Macht verfallen sind.
Gefühlt wird die Bundesrepublik seit Ewigkeiten von einer großen Koalition regiert. Merkels Union und die SPD unterscheiden sich kaum noch. Werden im September die Ränder von diesem „eingefrorenen Zustand“ in der Mitte profitieren, vor allem die Rechtspopulisten?
Das galt zumindest in der Vergangenheit nicht, wenn wir das klassische Verständnis von Links und Rechts als Maßstab nehmen. Stattdessen ist eine Auseinandersetzung über den Konsens in gesellschaftspolitischen und kulturellen Fragen erwachsen. Dafür steht der Konflikt zwischen Grünen und AfD, der eine neue Konfliktlinie bedient. Deren Differenz ist deutlich größer als zwischen Union und SPD auf der alten Rechts-links-Achse. Das schärft deren Profil.
Sollte die AfD im Osten wieder überdurchschnittlich gut abschneiden: Wie lange lässt es sich durchhalten, dass alle denkbaren Koalitionen gegen sie gebildet werden – einzig mit dem Ziel, eine AfD-Regierungsbeteiligung zu verhindern?
Man muss zwei Übel miteinander abwägen. Die AfD kann in Reaktion auf diese Abgrenzungsstrategie nochmal drei bis vier Prozent dazugewinnen. Die Kehrseite ist die Normalisierung der Partei, wie wir es in Österreich mit der FPÖ gesehen haben. Zwar sehen wir in Ländern, in denen autoritär-populistische Parteien kleine Koalitionspartner sind, bisher keine dramatische Demokratieverschlechterung. Aber eine Regierungsbeteiligung kann ein Sprungbrett dafür sein, stärkste Partei zu werden. Unter Abwägung der beiden Übel finde ich die Abgrenzungsstrategie im Sinne der Stabilität der Demokratie die bessere.
Michael Zürn (62), in Esslingen geboren, studierte und promovierte an der Universität Tübingen. Professor für Politikwissenschaften, erst an der Uni Bremen, dann an der FU Berlin. Zeitweise Gründungsrektor der Hertie School of Governance. Heute Direktor am Wissenschaftszentrum für Sozialwissenschaften in Berlin und Sprecher des internationalen Exzellenzclusters „Contentations of the Liberal Script“ zu den Herausforderungen der liberalen Demokratien.
Erstveröffentlicht am 12.3.2021 in der Südwest Presse
Bildquelle: Pixabay, Bild von Gerd Altmann, Pixabay License