Uwe Timm schildert in seinem Roman Alle meine Geister, wie er als 14jähriger auf Geheiß des Vater eine Kürschnerlehre beginnt. Das war im Jahre 1954. Das Kürschnerhandwerk ist ein sehr apartes, das hohe Anforderungen an den Ausübenden stellt. Nicht nur deswegen hat das Buch mich fasziniert, sondern weil Timm nicht nur seine persönliche Entwicklung schildert, sondern weil er gleichzeitig ein Panorama der Nachkriegszeit liefert: das Wiedererstarken der restaurativen Kräfte in Politik und Ökonomie; die Wiederaufrüstung, den kulturellen Mief der 50er Jahre und die Kollateralschäden des sog. Wirtschaftswunders, nicht zuletzt für das eigene Handwerk.
Besonders hervorzuheben ist, mit welcher Akribie Uwe Timm Kürschnerhandwerk schildert. Dieses erfordert Materialkenntnisse, diverse Techniken des Zurechtschneidens und Zusammennähens von Fellen und Lederteilen, einen Sinn für Farbenkonstellationen und nicht zuletzt die kreative Präzision im Umgang mit dem kostbaren Material.
Minutiös schildert der Autor diese Handwerkstugenden anhand der Figur seines Meisters namens Kruse, der das Handwerk perfekt beherrscht. Ihn bewundert und verehrt der junge Timm, auch weil er ihn wegen seiner politischen Überzeugungen schätzt. Er wird sein Mentor, der ihm einiges an geschichtlichen Zusammenhängen vermittelt. Mit August Bebel hätte es 1914 keine Zustimmung der Sozialdemokraten zu den Kriegskrediten gegeben…. Von Friedrich Ebert hält er wenig. Zu viele Zugeständnisse an die Reichswehr, die dann die zarten Pflänzchen der Rätebewegung zerschlugen.
Kruse ist Kommunist und Betriebsrat; vor allem aber einer, der seinen Handwerkerstolz auch gegenüber dem Eigentümer des Betriebes zum Ausdruck bringt. Er ist der Einzige, der dem Chef widerspricht, weil er weiß, dass dieser auf ihn angewiesen ist. Sein Credo lautet: Politische Arbeit und handwerkliches Können gehören zusammen. In einer der eindrucksvollsten Passagen des Romans heißt es:
Kruse, der durch Erfahrung, Wissen, Genauigkeit und Ausdauer in seinem Fach nicht nur zum Meister, sondern zum Künstler geworden war. Er war nicht zu ersetzen. Eine genau zu beobachtende, erst später für mich auf den Begriff zu bringende Herr-Knecht-Dialektik. Wie ich auch bei der Lektüre von Richard Sennetts ‚Handwerk’, worin er die Künste dem Handwerk so schwesterlich nah deutet, Walther Kruse vor Augen hatte. Die Obsession der Genauigkeit, die Achtung gegenüber der Besonderheit des Materials und die Verpflichtung, dieses in eine perfekte Form zu bringen, ist ein sinnbildender Prozess. Er ist das emotionale Gegenteil zu dem verbreiteten: Passt schon. In Walther Kruse fand der Handwerker zu seiner Autonomie.
Ein weiterer Aspekt des Handwerks, auf den Uwe Timm geradezu wehmütig zurück blickt, ist die Tatsache des weitgehend selbstbestimmten Arbeitens. Obwohl es Termine gibt, zu denen ein Auftrag zu erfüllen ist, wird der Rhythmus der Arbeit noch nicht von Maschinen oder Automaten vorgegeben. Es gibt immer wieder Zeiten für persönliche Kontakte und Gelegenheiten zum Erzählen.
Das war die Zeit des Erzählens, von dem Walter Benjamin in seinem Essay ‚Der Erzähler’ sagt: Erfahrung, die von Mund zu Mund geht, ist die Quelle, aus der alle Erzähler geschöpft haben. Und unter denen, die Geschichten nieder geschrieben haben, sind es die Großen, deren Niederchrift sich am wenigsten von der Rede der vielen namenlosen Erzähler abhebt.
Die Erzählung, wie sie im Kreis des Handwerks- des bäuerlichen, des maritimen und dann des städtischen – lange gedeiht, ist selbst eine gleichsam handwerkliche Form der Mitteilung. Aus den zwei Urformen des Erzählens aus dem bäuerlichen und maritimen Umkreis hat sich die des Handwerks herausgebildet.
Uwe Timm hat das Handwerk des Kürschners keineswegs romantisiert. Im Gegenteil: er ist sich dessen Vergänglichkeit und Aussterben voll bewusst. Was ihn umtreibt, ist die Erinnerung daran festzuhalten; welche persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten dieses Handwerk erfordert und auf welche Weise es andrerseits Persönlichkeiten formt.
Hochinteressant ist, wie der Autor den Prozess der Persönlichkeitsfindung dadurch untermauert, dass er seinen recht beschwerlichen Bildungsweg mit einbezieht. Immer wieder streut er Erkenntnisgewinne ein, die auf eine Lektüre, Theateraufführung oder Musikerfahrung verweisen. Diese werden nicht abgehoben eingestreut, sondern stehen in enger Beziehung zu seiner praktischen Tätigkeit bzw. zu den Lernprozessen, die er dabei vollzieht. Was er schildert, könnte man als die Erfahrung einer ganzen Generation bezeichnen: die Entdeckung neuer Autoren: Camus; Sartre: Nietzsche; Hemingway; Salinger; Benn; Brecht u.a. Dann ist es vor allem die Jazz- und Rockmusik, die begeistert aufgenommen werden; immer auch als Widerstandsmoment gegen den kulturellen Mief der fünfziger Jahre. Nicht zu vergessen die Entdeckung und ‚Befreiung’ der Sexualität. All dies sind Elemente eines persönlichen Entwicklungsprozesses, der durch die Auseinandersetzung mit der älteren Generation, die die Nazivergangenheit am liebsten verschweigen möchte, noch an Konturen gewinnt.
Der Roman besticht durch seine Authentizität. Das meint hier: der Autor hebt nicht ab; er bleibt dem Milieu seiner Herkunft und den Personen, die ihn geprägt haben, verbunden. Das unterscheidet ihn z.B. von Didier Eribon. Timm schildert seinen Werdegang präzise und poetisch, vor allem aber: glaubwürdig. Das machte die Lektüre für mich zu einem besonderen Lesevergnügen; nicht nur, weil ich viele der Erfahrungen des Autors aufgrund eigenen Erlebens (Volksschule; Lehre, Zweiter Bildungsweg usw.) sehr gut nachvollziehen konnte.
Uwe Timm: Alle meine Geister; Kiepenheuer & Witsch -Verlag
Bildquelle: Public Domain

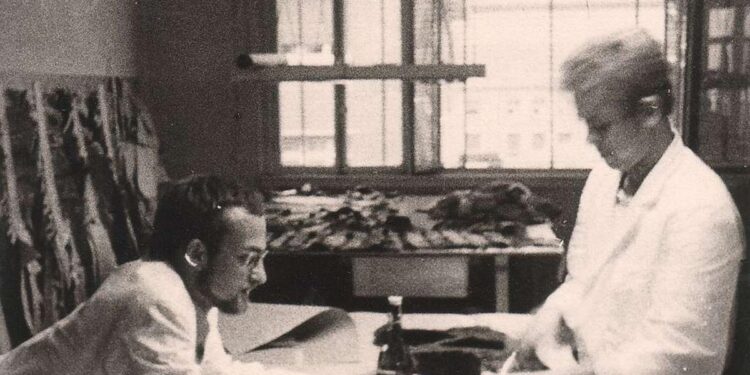












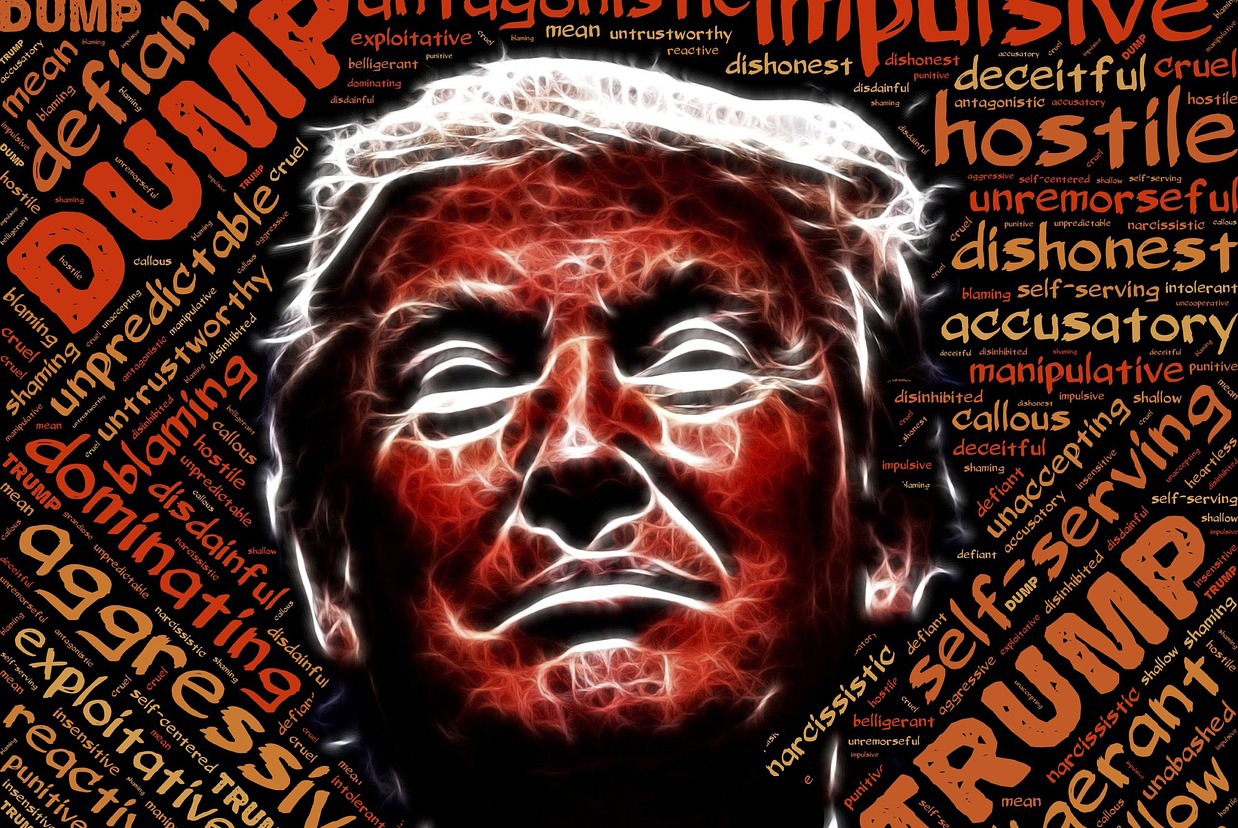

 Unser Blog lebt durch Sie!
Unser Blog lebt durch Sie!