Der „Kompromiss“ ist nicht nur im politischen Berlin zurzeit in aller Munde, sondern er findet sich als Forderung und als Verheißung (einer besseren Zukunft) auch in nahezu allen Leitartikeln
Gemeinhin redet man gern, wenn er negativ betrachtet wird, von einem faulen Kompromiss, den es zu vermeiden gelte. Oder aber von einem fairen oder gerechten Kompromiss, der so etwas ist wie das Meisterstück politischer Verhandlungskunst.
Dabei ist – und wir bleiben jetzt bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD – zunächst einmal zu überlegen (oder zu fordern), ob es nicht besser wäre, die Parteien suchten nach einem Konsens, einer übereinstimmenden Sicht auf Analyse der Lage und auf politische Forderungen, die sich daraus ergeben. Fänden die schwarz-roten Koalitionäre einen Konsens in möglichst vielen Politikfeldern, wäre dies allemal besser als ein Kompromiss, der, kaum geschlossen, dann doch wieder unterschiedlich interpretiert und umgesetzt wird. Dies birgt Zündstoff in sich und ist oft genug Stoff für Streit. Die gescheiterte „Ampel“-Koalition lässt grüßen.
Eine Suchmaschine definiert den Kompromiss als „Übereinkunft oder als Einigung durch gegenseitige Zugeständnisse“. So weit – so richtig. Oft aber ist der Kompromiss nur ein Tarn-Wort für einen politischen Teppichhandel, für politische Tauschgeschäfte.
Machst Du mir ein Zugeständnis bei der Reform des § 218 StGB, mache ich Dir eines bei der Mütterrente. Das ist eigentlich kein Kompromiss, sondern ein politischer Wühltisch
Kompromisse sind – und hier ist das Wort ausnahmsweise einmal angebracht – eigentlich nur innerhalb eines in sich geschlossenen politischen Sektors möglich (und sinnvoll). Zwei Beispiele: Wenn man sich entschieden hat, ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen, kann man zwischen den Höchstgeschwindigkeiten 100 km/h und 130 km/h einen Kompromiss suchen. Aber der Grundsatzfrage, ob überhaupt eine Geschwindigkeitsbeschränkung eingeführt werden soll, kann man damit nicht entkommen. Gleiches gilt bei der Cannabis-Freigabe: Erst wenn das „Ob überhaupt“ entschieden ist, kann man nach einem Kompromiss suchen, ob nun drei oder sogar fünf Cannabis-Pflanzen zu Hause auf dem Fensterbrett stehen dürfen.
Merke: Kompromisse sind in der Politik notwendig, gewünscht und oft möglich. Aber sie ersetzen nicht Entscheidungen.
Kompromisse können übrigens auch sachlich falsch sein. Ein einsichtiges arithmetisches Beispiel für diese Wahrheit hat bereits vor Jahrzehnten Lothar Späth formuliert, der ehemalige CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, dem der schwäbische Ehrentitel eines „Cleverle“ verliehen worden war. Er hat einmal gesagt: „Wenn der eine sagt, zwei Mal zwei ist vier, und der andere sagt, zwei Mal zwei ist sechs, dann ist fünf zwar der Kompromiss, aber es ist trotzdem falsch“.
Eine historische Anmerkung am Rande: Späth hat es – in seiner zweiten Karriere als Unternehmenschef der Jenoptik AG in Jena – verstanden, Kompromisse zu schmieden zwischen den eingeübten DDR-Planwirtschafts-Gewohnheiten der Stamm-Belegschaft des ehemaligen volkseigenen Kombinats und den Erfordernissen eines marktwirtschaftlich ausgerichteten Unternehmens. Das ging nicht ohne Brüche und Friktionen ab, aber es ging- mit manchen Kompromissen – insgesamt friedlich und erfolgreich aus.
Also: Kompromisse sind noch keine Garantie dafür, dass die Entscheidungen auch sachlich einwandfrei sind. Gleichwohl ist es richtig, nach Kompromissen zu suchen. Aber man suche zugleich – bitte – auch nach Übereinstimmungen in der Lagebeschreibung, nach Konsens und nach Gemeinsamkeiten n den Zielen und den Handlungen.
Bildquelle: Pixabay

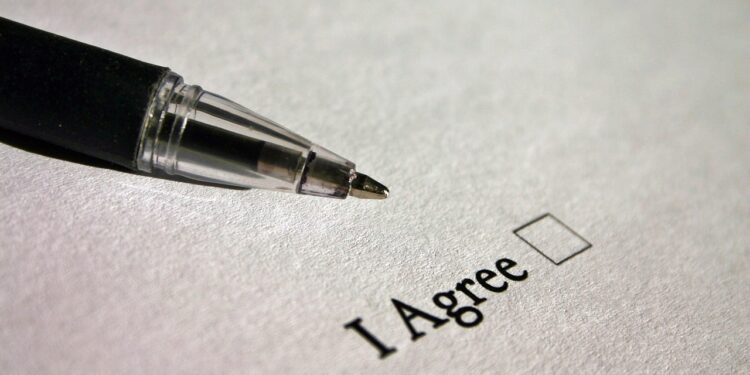










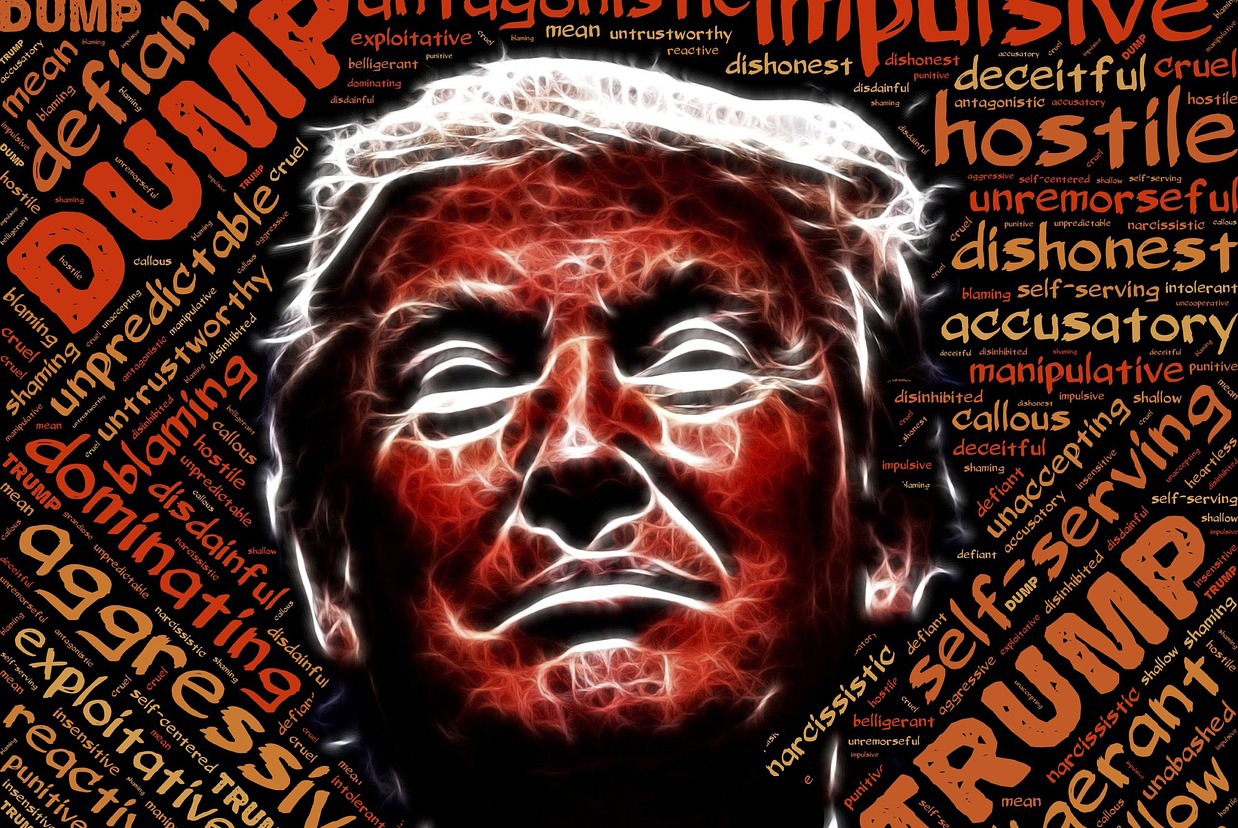



 Unser Blog lebt durch Sie!
Unser Blog lebt durch Sie!