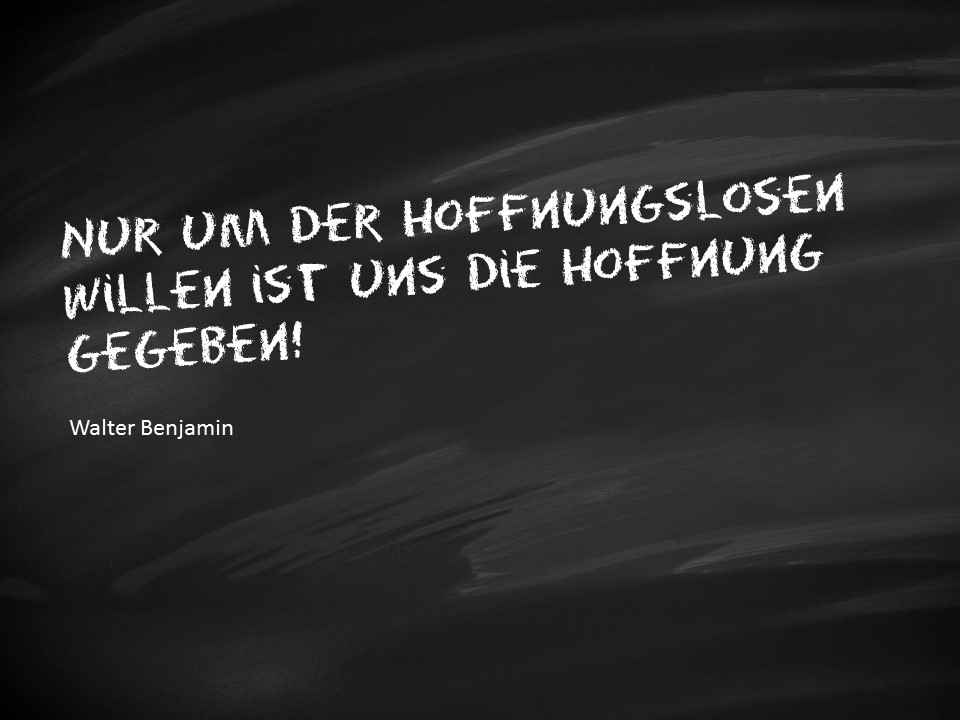Jürgen Becker wurde 1932 in Köln geboren; verlebte eine Kriegs-Kindheit in Erfurt und kehrte 1947 nach Westdeutschland zurück. Seit 1950 wohnt er wieder in seiner Geburtsstadt Köln. Seit 1959 arbeitete er für den WDR. Von 1974 bis 1994 leitete er die Hörspielredaktion des Deutschlandfunks in Köln.
Becker erhielt zahlreiche Literaturpreise: u.a. 1967 den prestigeträchtigen Preis der Gruppe 47; den Heinrich-Böll-Preis (1995) und den renommierten Büchner-Preis (2014). In ihrer Begründung schrieb die Darmstädter Jury: In Beckers Schreiben durchdringen sich die Zeiten, Beobachtetes und Erinnertes, Persönliches und Historisches. Seine Gedichte lehren uns eindringlich, unsere Welt und unsere Sprache aufmerksamer wahrzunehmen. Sie geben dem leichthin Übersehenen seine Würde zurück, machen unsere alltäglich erlebte Welt auf neue Weise sichtbar und unvergesslich.
Der Zugang zu Beckers Literatur ist kein einfacher: sein Stil ist ein enorm verdichteter. Das ist ganz wörtlich zu nehmen. Gedichte sind es überwiegend; aber auch seine Prosa kann man lesen wie Gedichte – so rhythmisch und atmosphärisch gehaltvoll kommt das von ihm Geschriebene daher. Wie ein moderates Stakkato; sanft und bisweilen eher lakonisch – wie nebenbei gesagt. Vor sich hin gesprochen. Ein Selbstgespräch mithin? Das ist wohl jede Literatur zunächst einmal: eine Selbstverständigung; ein Versuch, Erfahrungen von Wirklichkeit zu vergegenwärtigen; eine eigene Sprache für sie zu finden. Und er hat sie für sich gefunden: es ist ein unverkennbarer Stil, der sich gegen rasches Konsumieren sperrt.
Schon früh – das heißt Anfang der 1960er Jahre – ist sich Becker darüber im Klaren, dass sich für sein Verständnis von Schreiben keine festgefügten Gattungen anboten, die man einfach zu imitieren hatte. Becker sucht nach eigenen literarischen Ausdrucksmöglichkeiten, die es ihm erlauben, Alltägliches mit den Mitteln der Sprache zu formen. Er schreibt:
Was dabei entstand, waren sprachliche Reflexe dessen, was sich im Bewusstsein abspielte, dort im Kopf, wo sich die Phänomene des Alltags mit den Imaginationen, den Bildern der Vorstellungen und Träume mischten, die plötzlichen Augenblicke mit den Warteschleifen der Erinnerung, die Stimmen von der Straße mit den Geräuschen der Stadt, das tägliche Gerede mit den öffentlichen Verlautbarungen.
Abenteuer des Schreibens als offener Prozess
Becker wendet sich in seinem Text Felder (1964) konsequent gegen die Vorherrschaft literarischer Konventionen, die nach seiner Auffassung aufgrund ihrer rigiden Gattungsgrenzen nicht länger geeignet erscheinen, die Vielfalt, Widersprüchlichkeit und Komplexität moderner Lebenswelten zu erfassen. Becker versucht, für die vielfältigen Erfahrungsbereiche seiner Nahwelt jeweils spezifische literarische Ausdruckformen zu finden. Roman, Erzählung, Drama, Lyrik – das sind mehr oder weniger Begriffshülsen, die kaum noch etwas darüber aussagen, inwieweit sie geeignet sind, Wirklichkeitssegmente sprachlich zu erfassen. Becker versucht gar nicht erst, mit vorgeprägten Kategorisierungen der Wirklichkeit nahe zu kommen. Im Gegenteil: Für ihn ist entscheidend, sich im Schreibprozess die Wirklichkeit selber oder besser: die Erfahrung von Wirklichkeit sprachlich allererst zu erschließen. Es ist nicht mehr der souveräne Autor, der die Wirklichkeit nach Maßgabe seiner selbst gesetzten Kriterien strukturiert. Diese Art Literatur hält er für überholt. Nein, es ist das Abenteuer des Schreibens als offener Prozess – ein Prozess, der Überraschungen nicht ausschließt und bewusst der Gefahr des Scheiterns sich aussetzt.
Im Hinblick auf das Werk Beckers gewinnt man durchaus den Eindruck, dass dieses Weitersuchen noch immer andauert und kein Ende in Sicht ist. Anregungen für seine literarischen Versuche findet Becker u.a. in den progressiven Bildenden Künsten oder in der neuen Musik dieser Zeit.
Becker war in die Felder bis an die Grenze des literarisch Machbaren gegangen. Felder – das sind Wahrnehmungsbereiche, die er in jeweils eigenen Texteinheiten und Stilformen expliziert. Die Texte sind weder zeitlich noch räumlich angeordnet. Zusammengehalten werden sie durch die großstädtische Topographie (Köln und Umgebung). Erinnerungen, Irritationen, Frustrationen, Melancholie, Angst und Verstörung, bilden ein Kaleidoskop entfremdeter Lebenserfahrungen ab. Jedes Feld repräsentiert eine andere Sprachfigur. Zuweilen wirken die Texte so, als habe der Autor wahllos die wahrgenommenen Sprachfetzen seiner unmittelbaren Umgebung nahezu wörtlich mitgeschrieben und anschließend protokolliert. Dabei ergibt sich folgendes Darstellungsproblem: Die Gleichzeitigkeit verschiedener Vorgänge ist wahrnehmbar aber nicht darstellbar. In jeder syntaktischen Anordnung erscheinen die Vorgänge immer nur aneinandergereiht, nicht in ihrer wahren Dimension.
Thematisch berührt Becker das ganze Spektrum moderner Lebenswelten: Die Orte und Landschaften, in denen er lebt bzw. die ihm in Erinnerung geblieben sind und die durch die rasch voranschreitende industrielle Entwicklung zerstört zu werden drohen. Er registriert, wie Städte und Landschaften verplant und zersiedelt werden und der Lebensraum der Menschen immer stärker eingeengt wird. Wie Lärm und Hektik sich ausbreiten. Wie mittels neuer Medien und Technik die Kommunikations- und Erlebnisräume des familiären und nachbarschaftlichen Nahbereichs sich verändern und Erfahrungsweisen wie Stille, Ruhe, Abgeschlossenheit, Meditation oder Einsamkeit an Bedeutung verlieren. All diese Entwicklungen, die ein schier unerschöpfliches Material abgeben, werden melancholisch registriert: Man sagt, die Hälfte des Lebens findet im Konjunktiv statt. Was bleibt, wenn die andere Hälfte Erinnerung ist?
Becker unterzieht die vorgeprägten Floskeln, mit der Repräsentanten der Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Medien und Werbung uns die Reize der modernen Welt als die schönste aller möglichen Welten verkaufen wollen, einer Art Sprachrecherche. Er zeigt, dass die Art der medialen Landnahme ihre Wirkungen auch im Familien- bzw. Freundes- und Bekanntenkreis zeitigen:
Fanatiker des Authentischen
Wir sind lebhaft, frisch, erleichternd und anregend; wir sind gelb, raumauflösend und strahlend … Ihr seid meine lieben Freunde, ich bewundere euch. Ich bewundere euren Mut, Euren Witz und Eure Aggressivität. Eure Kaminfeuer und Urlaubspläne …
Vetter Wilhelm hat als Monteur eine schöne Karriere gemacht. Onkel Herrmann mit seinem Rauschgift war ein tragischer Fall und hatte Einflüsse von seiner Mutter, mit deren Familie niemals ein Kontakt bestanden hat … Kommt doch mal sonntags zum Federballspielen. Ariane, drittes Semester, sagt, dass diese Familie als Ausdruck der bestehenden Herrschaftsstrukturen zerschlagen werden muss. Auf dem Familientag werden die Filme vom vorigen Familientag gezeigt.
Becker bezeichnet sich einmal selbst als Fanatiker des Authentischen. Um das Authentische seiner Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen, müssen Risse, Brüche und Übergänge in den literarischen Formen in Kauf genommen werden. Nur dadurch ist es möglich, die Dinge allein durch das Erleben zu beglaubigen – sie so darzustellen, wie ich sie erlebt habe.
In seinem Beitrag Gegen die Erhaltung des literarischen Status quo findet sich der interessante Hinweis auf eine literarische Darstellungsform, die seinen Anliegen entspricht: das Journalführen. Becker knüpft an eine Formulierung von Peter Weiss an, der sich – ähnlich wie Becker – keine abgesonderten Kunstwerke mehr denken kann, nur einen unmittelbaren Ausdruck für eine gegenwärtige Situation, für eine fortlaufende Veränderung und Umwertung, und deshalb gäbe es nur ein Journalführen für ihn, ein Aufzeichnen von Notizen, Skizzen, Bildstadien, vielleicht durchmischt mit Improvisationen musikalischer, dramaturgischer Art, doch nie diese Bremsklötze eines Romans, eines durchgeführten Bildes.
Diese Charakterisierung von Weiss dürfte ziemlich präzise den programmatischen Vorstellungen Beckers entsprochen haben. Auch er wendet sich gegen die fiktiven Konstruktionen des Romans, wo der Autor aus einer Position des Wissenden schreibt, als sei die Welt übersehbar wie eine Fläche Papier. Er möchte die Bewusstseinsvorgänge so darstellen, dass sie den Prozess der Erfahrung selbst möglichst präzise abbilden.
Erfahrung vom bloßen Erleben unterscheiden
Offen halten wofür? Für neue Erfahrungen und demzufolge auch für eine neue literarische Form, die diesen entspricht. Dabei ist ihm klar, dass eine einmal gefundene Schreibweise auch wieder in Frage gestellt werden kann, da sie notwendigerweise immer auch Vorentscheidungen impliziert. Der Begriff der Erfahrung ist von dem des bloßen Erlebens zu unterscheiden. Erfahrungen resultieren aus der reflexiven Verarbeitung von Erlebnissen. Unterm Tisch lagen die Zeitungen der vergangenen Woche. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da alles gelesen habe, ich weiß aber, dass ich voll versorgt mit Kenntnissen und Informationen bin, mit den Meinungen dazu, den öffentlichen Reaktionen … ich kann die Lage genauestens beurteilen. Kann ich das? Was ist denn die Lage? Ich war nirgendwo dabei. Ich habe nichts gesehen. Natürlich sehe ich alles abends auf dem Bildschirm. Aber bin ich deshalb mit Augen und Ohren schon Zeuge? Dennoch, ich weiß Bescheid, ich äußere meine Meinung, ich rede über alles mit, ich kenne mich auf der Skala der Reaktionen aus, ein paar Reizwörter nur, und ich bin betroffen, ich äußere meinen Abscheu, ich verurteile schärfstens, ich mache mit aller Deutlichkeit klar, ich sage, was Fakt ist, ich sehe das alles in einem anderen Licht. Und wenn ich irgendwo bei Leuten bin, dann höre ich aus den Gesprächen und Diskussionen nichts anderes heraus, dann weiß ich bald, aus welcher Zeitung, aus welchem Kommentar das Bescheidwissen kommt, wie die gelesene Meinung zur eigenen Meinung wird …
Becker geht es darum, den Prozess der Erfahrung sprachlich zu rekonstruieren; er reflektiert das Erlebte noch einmal und reduziert es auf die wesentliche Sprachform. Wenn eingangs gesagt wurde, das literarische Verfahren Beckers zeichne sich vor allem durch die methodische Verdichtung aus, so wird jetzt deutlich, dass diese den Endpunkt eines längeren Reflexionsprozesses darstellt. Dabei fungiert das wahrnehmende Subjekt als Medium zwischen Sprache und Wirklichkeit. Es ist das Ich, das wahrnimmt, erfährt, unternimmt, redet, treibt, auflöst, verlässt, verschluckt, vergisst. Der Autor empfängt die Impulse seines Schreibens aus einem inneren Ressort, in dem das gegenwärtig Wahrgenommene, die Projektionen der Phantasie, die eigene Geschichte, das Erinnerte, die Orte, an denen er gelebt hat und lebt sowie die Bedingungen seiner Existenz ihren Niederschlag finden. Entscheidend ist, was in den Momenten des Schreibens der Schreibende in seinem Bewusstsein wahrnimmt, und zwar innerhalb des Zusammenhangs, der in den Momenten des Schreibens entsteht.
Nicht zu verwechseln mit Tagebuchschreiben
Das von Becker praktizierte Schreiben als Journalführen ist nicht zu verwechseln mit dem Tagebuchschreiben – mag letzteres noch so extensiv gehandhabt werden. In seiner Erzählung Der fehlende Rest (2002) heißt es: Einmal hatte Jörn mir vorgeschlagen, so etwas wie ein tägliches Journal zu führen. Sicher, ein Journal … aber am wenigsten mit der Absicht, das Zeitvergehen im Sinne eines dahinfließenden Kontinuums zu regulieren. Die Tage, die oft so zu verlaufen schienen, kamen mir vor wie Aufenthalte in einem abgelegenen Zimmer, in dem man nichts wahrnahm vom Leben nebenan, im Haus, unten auf der Straße. Wenn Du meinst, sagte Jörn, dass an einem einzigen Tag man gar nicht wahrnehmen und aufzeichnen kann, was an diesem Tag alles gleichzeitig passiert, und zwar in deiner allernächsten Umgebung, dann kannst du ja gleich aufhören, kannst du das? Das ist nicht die Frage, aber ich muß wissen, dass mit jedem Satz, den ich schreibe, ein anderer, möglicher Satz ungeschrieben bleibt.
Beckers Schreiben weist unverkennbare autobiographische Bezüge auf; aber alles Datierbare, Lokalisierbare, ja Private ist lediglich Ausgangspunkt für die sprachliche Konstruktion von Erfahrungsmustern, die sich neuen Erfahrungen immer aufs Neue öffnen. Becker betont des Öfteren die offene Struktur der Erfahrung (das gilt gerade auch für die historische Dimension von Erfahrung) und definiert in diesem Zusammenhang das Autobiographische als Momente der widersprüchlichen Erfahrung.
Das Journalführen ermöglicht es ihm, den Prozess der Erfahrung durch ein bestimmtes Verständnis von Ort und Zeit ein stückweit zu objektivieren. Am Ort interessiert ihn vor allem, wie er auf das Bewusstsein wirkt. Der Ort bestimmt die unmittelbare Gegenwart dessen, was vergangen, erdacht, möglich, anwesend und augenblicklich wirksam ist. Das heißt: Der Ort kann konkret in Erscheinung treten oder eine Synthese aus Erinnerungen oder Imaginationen sein.
Es gibt so viele Orte, an denen der Schrecken und die Schönheit gleichzeitig anwesend sind – aber dass die Zeit oft zögert, ihre eigenen Dimensionen zu offenbaren, dass Jahre und Jahrzehnte vergehen können, bis einem der Moment dieser Gleichzeitigkeit bewusst wird … Die Geschichte dieses Hauses, dieses Hofes kennt Zeiten, in denen seine Bewohner um ihr Leben zu fürchten hatten. Durchziehende Heere; plündernde, brandschatzende Feinde. Der brandrote Himmel im Westen, Flakgeschütze auf den Hügeln, näherkommende Einschläge, das Funkgerät unterm Kirschbaum, Gefangene hinter den Zäunen. Die unsichtbare Spur von Kriegen, die es nicht mehr gibt, nicht hier. Von anderswo kommen nur Bilder; jeden Abend ein paar Minuten Fortsetzung aus dem endlosen Kriegsfilm; die Zuschauer, wir sind in keiner Gefahr. Die mit den eigenen Narben hier, sie sterben in Frieden langsam aus. Der Schnee draußen erzählt, dass die Ruhe wie ein Märchen aussieht.
Spurengeflecht aus Früher und Jetzt
Immer ist es das Ich mit seinen gegenwärtigen Bedingungen, das sich erinnert. Und du weißt: die Vergangenheit fängt immer sofort an. Dies und das hält die Erinnerung ja fest, aber das geschieht derart unbewußt, dass du nie genau weist, was so eine Stunde Bemerkenswertes, Wichtiges zurücklässt. Um die entscheidenden Vorkommnisse musst du dich nicht kümmern; sie nehmen von allein ihren Platz im Gedächtnis ein. Das Bewusstsein erfährt die Wirklichkeit als Objekt der vergangenen bzw. vergehenden Zeit. Dieses Spurengeflecht aus Früher und Jetzt, zieht sich durch alle Tage, die auf diese Weise erinnert werden.
Ein kurzes Jahr wird das. Es ist kein Film, sondern wirklich, das schnelle Leben. In ein altes Uferbild möchte ich hineinwandern; der Nachen treibt an Büschen und Bäumen vorbei aus der Bucht vorbei am Fischerdorf und hinten über dem Wasser blinken Türme der Hansestadt. Die Autobahnbrücke wächst grün; die grüne Autobahnbrücke liegt im Wasser; da ist die grüne Autobahnbrücke wieder, und jetzt ist Nacht … Wenn man anfängt, sich mit seinem Todestermin zu beschäftigen, geht man noch einmal die Liste der Möglichkeiten, der Versäumnisse, der Begrenzungen, der Erwartungen, der Fragmente, der Abschlüsse, der Hoffnungen durch … Das Interesse an einem bestimmten Ort ist bestimmt vom Interesse an einem Stück Autobiographie; was heißt jetzt Autobiographie: es sind Momente der widersprüchlichen Erfahrung. Nach einer durchsoffenen Nacht sitze ich an einem frühen Morgen auf einem Kilometerstein am Strand und warte auf die aufgehende Sonne … Und die Flusswiesen glänzen auf in der aufgehenden Sonne. Das waren die Zeiten, in denen wir aus den Zelten schlüpften und hinüberschwammen an andere Ufer; das waren die Zeiten, vor durchgesoffenen Nächten, die Zeiten, südlich, flussaufwärts. Die Stromkilometervermessung des Rheins beginnt in Konstanz; wir befinden uns in der Nähe des Stromkilometers 682, linksrheinisch. Erste.
Neben dem Umgang mit Ort und Zeit zeigt die zitierte Passage, dass Beckers Aneinanderreihung assoziativer Bewusstseinsmomente immer wieder reflexiv gebrochen werden (es ist kein Film, sondern wirklich). Die diskontinuierlichen Abläufe lassen sich sprachlich nur als eine Abfolge von Ereignissen darstellen. Die Gleichzeitigkeit der Wahrnehmungen ist sprachlich nicht fixierbar. Diese Schreibproblematik reflektieren Beckers Texte im Schreibvorgang selbst noch als subjektiv wahrgenommene Erfahrung, dass alles schön der Reihe nach aufgezählt werden muss.
Melancholie, Nachdenklichkeit, Trauer
Welche Stimmungen rufen die Texte Beckers hervor? In erster Linie wohl Melancholie, Nachdenklichkeit, Trauer und schließlich so etwas wie ein trotziges Dennoch, angesichts des Zustands der Welt, der Zerstörung von Landschaften, des Vergehens der Zeit. Beckers Texte sind voller Beispiele für derartige Stimmungen:
Eine Küste macht mich zärtlich und ich streichle den Sand. Plötzlich langweilt mich ein Fluss, in dem ich gestern noch hätte ertrinken können.
Ich wache eifersüchtig über die Unantastbarkeit der Wälder. Ich umarme ein Kornfeld. Gruppen von Pappeln – und ich erinnere mich an den Abschied von Pappeln.
Es ist alles so finster heute, so trübe, blöde und öd. Es fängt nichts an, es geht nichts weiter, es hat keinen Zweck mehr, es hilft nichts, es kommt keine Sonne auf, weder am Himmel noch im Herzen. Es ist ein unbeschreiblicher Zustand. Es kommt keiner und sagt, dass es nicht mehr zum Aushalten ist.
Keine Erinnerung mehr, wir verinseln immer mehr.
Nun ist wieder Zeit vergangen und wir haben viel vergessen. Morgens ist es am schlimmsten; es dauert schon ein Weilchen, bis wir wieder wissen, wo wir jetzt sind, was wir anfangen, wohin weiter.
Und faszinierend wird nur das Gesicht der Gleichgültigkeit sein, und der Schlaf wird nie seine Zukunft verlieren.
Wenn Armut ein Schicksal ist, muß niemand ein schlechtes Gewissen mehr haben.
Da redet man besser erst gar nicht drüber.
Warum wir hier sind, darüber denken wir schon gar nicht mehr nach; man lebt schon halbwegs bequem. Was macht die alte Heimat? Wer hier was hört, hält sich gleich die Ohren zu. Einmal draußen, heißt es, bleibt man besser gleich draußen. Verrückt wird hier keiner, weil das Gedächtnis verdammt gut hier schlafen kann. Ja, wir verschlafen den halben Tag. Nachts, da werden wir lustig. Geschimpft wird nur noch halb soviel, obschon es immer Anlaß gibt. Die Gäste, die da öfters kommen, bellen nicht und beißen nicht; wir haben nichts zu erzählen. Wir sind manchmal verwirrt; was wir zu sehen glauben, verschwindet gleich wieder; im Kopf ein Rauschen; verwischte Welt. Sprichwörterzeit.
Es wird gelacht, es heißt, man sagt, das muß man wissen, und was meinen wir dazu, und wer sind wir eigentlich denn.
Nicht gemacht sein für diese Zeiten.
Dahinten, das ist wohl Zukunft – da sieht man doch nichts, dahinten.
Da sind wir ja n o c h und wir sprechen von dem, was langsam verschwindet und an seinen Rändern n o c h erkennbar bleibt.
Im Selbstgespräch kämpft das Gedicht gegen die Stummheit der Einzelnen und das Vergessen der Mehrheit.
An dieser Stadt ist nichts mehr zu beschreiben, nur abhauen hier – so wären wir fertig und könnten nun gehen, aber wir sind es nicht.
Motive dieser Art durchziehen das Werk Beckers wie ein roter Faden. Sie zeugen von der Sensibilität des Autors für seine Umgebungen – und das ist jeweils der Ort in der Welt, an dem er sich gerade befindet: als einer der weiß, dass seine Zeit auf Erden endlich ist und der gleichwohl dagegen anschreibt. Als Motto über seinem Werk könnte der Ausspruch Walter Benjamins stehen: Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben.