Mit Hängen und Würgen haben sich Kanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Vizekanzler Robert Habeck auf einen Haushaltsentwurf geeinigt. Ob er Bestand hat, werden erst die Beratungen im Bundestag zeigen. Es ist das Königsrecht des Parlament, darüber zu entscheiden. Dabei berufen sich die Abgeordneten oft auf das „strucksche Gesetz“. Was es bedeutet und wie es entstanden ist.
Die Geburtsstunde begann mit einem riesigen Eklat. Die Schlagzeile war verheerend. Noch verheerender das fast blatthohe Bild. Ein Foto von Peter Struck, das erst zusammen geknüddelt und dann provisorisch geglättet worden war. Darauf der Titel: „Schröder faltet Struck zusammen“. Eine mediale Aggression erster Klasse durch die Bild-Zeitung, die der SPD-Fraktionsvorsitzende über sich ergehen lassen musste. Das Boulevardblatt hatte zur Vernichtungsschlagzeile ausgeholt. Tatsächlich sah es eng aus für Struck, der an diesem 25. August 1999 nicht einmal ein Jahr im Amt war. Genüsslich zitierte Bild aus der Kabinettssitzung, in der der Kanzler dem Fraktionschef vorwarf: „Was Du angerichtet hast, ist eine Katastrophe.“
Anlass für die medial inszenierte „Gardinenpredigt“ im Kabinett war genau betrachtet eine Lappalie. Am Tag vor der schröderschen Abkanzlung hatten sich Struck und die Fachpolitiker der Fraktion mit Vertretern von Gewerkschaften und Sozialverbänden getroffen, um im Konflikt der Gruppierungen mit der Regierung über eine geplante Rentenreform zu vermitteln. Hauptstreitpunkt: Die Absicht der Regierung, in den kommenden zwei Jahren die Rentenerhöhung zur Stabilisierung der Kassenlage zu beschränken und die gesetzlich vorgeschriebene Orientierung an der Entwicklung der Nettolöhne zu umgehen.
Struck ließ keinen Zweifel aufkommen, dass der Gesetzentwurf nicht zu verhindern sei und in den Bundestag eingebracht werde. Als Trost hatte er für die aufmüpfigen Gewerkschafter nur eine parlamentarische Binse parat. In fast allen Gesetzesverfahren, beschrieb er die Realität, gäbe es bei den Beratungen in den Ausschüssen und im Plenum Änderungen und Korrekturen. „Kein Gesetz“, moderierte Struck die Empörung herunter, „verlässt den Bundestag so, wie es hereingekommen ist.“
Eine beschwichtigende Formel. Und ein Hinweis darauf, dass das Gesetzgebungsverfahren mit der Einbringung in den Bundestag nicht beendet ist, sondern erst beginnt. Dass Gesetze nicht von der Regierung, sondern vom Parlament beschlossen werden. Ein Satz von solcher Selbstverständlichkeit, dass ihm ohne den Schröder-Auftritt im Kabinett niemand Bedeutung zugemessen hätte.
Ein Satz, der dem Kanzler offenbar im Gedächtnis blieb. Monate später griff er ihn bei einer Tagung der Seeheimer auf. In der Fraktion war der Unmut über ein Gesetz zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes groß. Die Befürchtung: Arbeitnehmerrechte könnten geschliffen und den Forderungen der Wirtschaft geopfert werden. Um zu beruhigen warf Schröder ein: „Leute, es gilt das strucksche Gesetz.“ Und zitierte den Satz des Fraktionsvorsitzenden.
Zwei Jahrzehnte später beschrieb der Spiegel in einer Geschichte zum zehnten Todestag von Peter Struck: „Ein Satz bekam Flügel und hob ab.“ Zunächst beriefen sich nur SPD-Abgeordnete in internen Sitzungen auf diesen Verfahrensvorbehalt. Bald beriefen sie sich im Bundestag auf das „strucksche Gesetz“. Und irgendwann war das Gesetz auch in den anderen Fraktionen zur gängigen Redensart geworden. In internationalen Standardwerken über Parlamentarismus wird das mit dem Namen Struck verbundene „Gesetz“ erläutert als Diktum, dass nicht die Exekutive, sondern die Legislative das letzte Wort im Gesetzgebungsverfahren hat.
Peter Struck, der 2012 kurz vor seinem 70. Geburtstag starb, hätte es gefallen, dass er mit diesem „Gesetz“ lebendig bleibt. Aber dass er das „strucksche Gesetz“ erfunden und „geschickt mit seinem Namen verbunden“ hat, wie CDU-Fraktionschef Friedrich Merz 2022 im Spiegel ohne Kenntnis der wahren Entstehung fabulierte, ist Unsinn. Struck hätte ihm in seiner herzlich-rauhbeinigen Art das geraten, was er manchem seiner Abgeordneten mit auf den Weg gab: „Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.“
Übrigens: Die öffentlich gemachte Kanzlerschelte im Kabinett hatte für die Zusammenarbeit von Regierung und Fraktionen eine sehr entscheidende Konsequenz. Nicht nur Peter Struck hat als Chef einer Regierungsfraktion nie mehr an einer Kabinettssitzung teilgenommen, wie es bis dahin in der Bundesrepublik üblich war. Nicht, weil er beleidigt war: Ihm war es wichtig zu dokumentieren, dass es zwischen Fraktion und Regierung kein blindes Einvernehmen geben müsse. Das wurde stilbildend für die meisten Koalitionskonstellationen. Und hat bis heute Bestand für SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Weil nicht die Regierung, sondern das Parlament über Gesetze entscheidet.
Erstveröffentlichung in www.vorwaerts.de

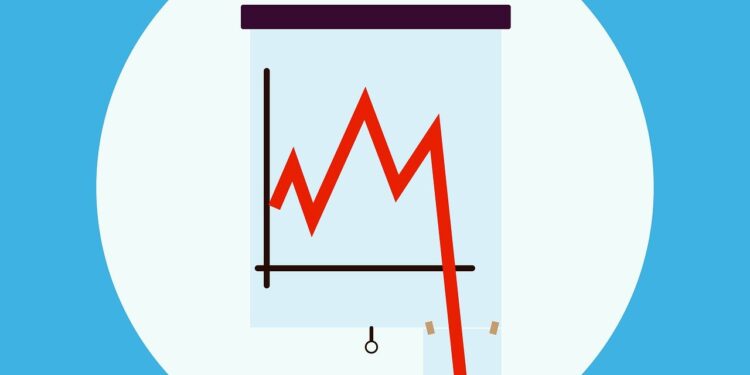














 Unser Blog lebt durch Sie!
Unser Blog lebt durch Sie!