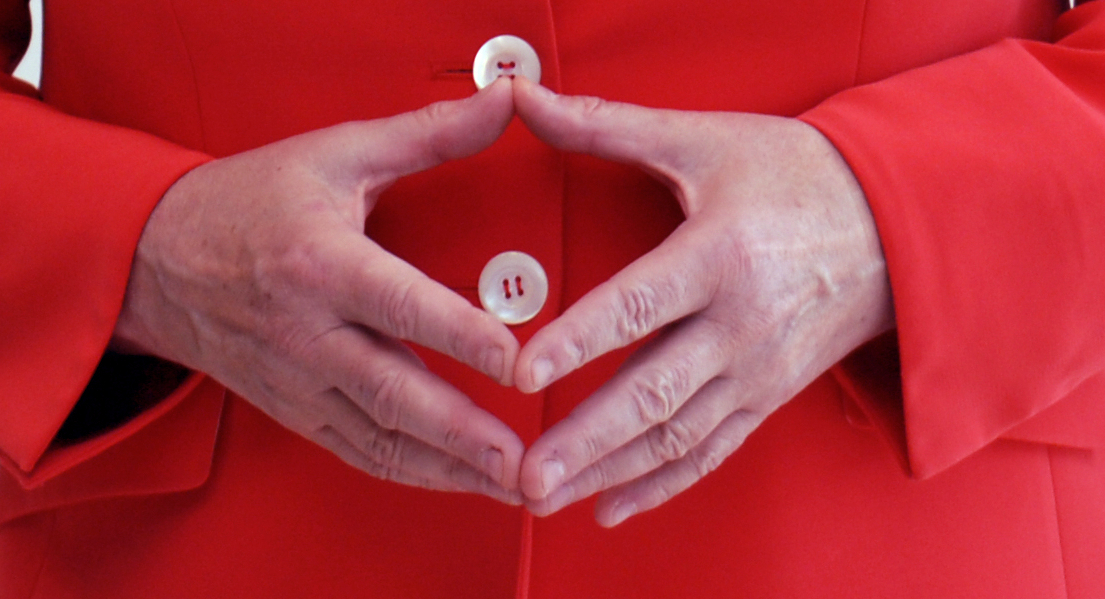Der Name „Berlin“ stammt aus der slawischen Sprache und heiß einfach „die Stadt im Sumpf“. Und von dort steigen regelmäßig Blasen auf, manchmal auch giftige Gase. Aktuell sprudeln dort Sprechblasen aus der SPD. Konkret: der ehemalige Bundestagspräsident und Berliner SPD Genosse Wolfgang Thierse diagnostiziert eine zunehmende Segregation, also das Trennende in der Gesellschaft. Er verweist dabei auf Extrempositionen im linken und rechten Spektrum, z.B. in der Genderpolitik. Er fordert mehr Solidarität. Aber wo sind die Klammern, die den Gemeinsinn fördern? Beim Flüchtlingsproblem 2015 gab es sie. 8 Millionen Menschen haben sich an der Erstversorgung der Geflüchteten beteiligt.
Die SPD diskutiert darüber schon lange lustvoll und heftig. Aber leider nicht über deren Wohnungssituation.
Aber über die Tagesordnung wird gestritten. Die Forderung von August Bebel vor dem Weltkongress der Sozialisten, dass die Partei „unter dem Hammer“ in der Hand des Vorsitzenden sein muss, würde heute nur noch lautes Gelächter auslösen. Man hämmert nicht mehr, sondern diskutiert. Basta ist auch obsolet. Autoritäten sind out. Empfindlichkeiten in. Die Reaktion auf Thierses braven Aufsatz: die Ko-Bundesvorsitzende Saskia Esken und der stellvertretende Bundesvorsitzende Kevin Kühnert schämen sich für den Altgenossen wegen seiner „rückwärtsgewandten“ Gedanken. Was dann in folgenden verbalen Scharmützeln inhaltlich gesagt wurd, ist es nicht wert, aufgeschrieben zu werden. Es sind Vorwände, um die eigenen Aggressionen loszuwerden. Eine Aussprache unter den Genossen von Angesicht zu Angesicht fand schon deshalb nicht statt. Dann wäre wohl bei einigen die Erleuchtung gekommen, dass es für eine fortschrittliche Partei notwendig ist, sich die Probleme von Minderheiten anzuhören. Ohne die der großen Mehrheit aus den Augen zu verlieren.
Ein Blick zurück: Im Langzeitprogramm I (Orientierungsrahmen 1973-1985) hat die SPD u.a. die Forderung nach einer „spürbaren Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktionsvermögen von Großunternehmen“ beschlossen. Die Partei war schon mal weiter. „Neukölln ist überall“ heißt der Titel des Buches des ehemaligen Bezirksbürgermeisters Heinz Buschkowsky. Diese kühne Behauptung nährt den Verdacht, dass Berliner Politiker, nicht nur die der SPD, glauben, die Stadt sei die Brutstätte der Ausländerkriminalität oder einer progressiven Leitkultur für die zweite deutsche Republik. Leider herrscht dort auch und in den Berliner Ortsvereinen eine Lagermentalität, die sich nach dem Mauerfall nicht in Luft auflöste.
Die traditionelle Spaltung in der SPD verläuft zwischen den Vertretern des Grundsätzlichen und des Praktischen. Das ist fruchtbar, wenn man miteinander redet. Leider kennt man sich zu gut. „Ihr müsst mal den Finger in die Erde stecken und daran riechen“, rief einst ein Juso-Wikinger von der Insel Sylt den Delegierten auf dem Juso-Bundeskongress in Hannover zu, als diese darüber stritten, ob der Staat nun der bessere Gesamtkapitalist ist oder als solcher wirkt. Wie einst der Nordsee-Insulaner ticken die Provinzler anders als die Hauptstädter. Der erste blickt über die Weite des Meeres. Viele Berliner Genossen schauen nur gegen Mauern. Das verengt den Blick.
Ziel einer politischen Willensbildungsgemeinschaft ist, Mehrheiten zu erreichen. „Von mir aus kann jemand seinen Hamster heiraten“, sagt das ehemalige SPD-Mitglied, die Journalistin Gitta L.. Vielleicht sollte die Partei mal wieder über den Armutsbericht diskutieren oder die skandalöse Vermögensverteilung. Es ehrt die SPD, dass sie dabei selten dem Populismus verfiel. Man sagt, der Berliner habe Schnauze mit Herz. Der verstorbene ehemalige Regierungssprecher Klaus Bölling (SPD), selbst Berliner, meinte, oft fehle das Herz. Vielleicht steht deshalb im neuen Grundsatzprogramm so oft das Wort „Respekt“. Allein menschliche Vorbilder wirken. Aber nicht nur die SPD braucht Leuchttürme.
Der legendäre Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner (der Onkel) rief einst den Genossen zu: „Unsere Stärke muss sein: orientieren statt irritieren“. Auch daran muss man die heutige Führungsspitze der SPD messen. Die innenpolitischen Probleme der SPD haben zahlreiche Facetten.
Eine Sozialanalyse, wie sie einst der Bundesgeschäftsführer Peter Glotz erstellen ließ, ist dringend notwendig. Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kann sich da verdient machen. Die Partei war schon mal weiter. Das aktuelle Sprechblasenfestival ist im Grunde ein Führungsdebakel im Willy-Brandt-Haus. Parteivorsitzende müssen über operative und strategische Kompetenz verfügen. Wenn Charisma hinzukommt, ist das in einer Fernsehgesellschaft schon der halbe Erfolg. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt definierte Politik als „Kampfsport“. Von Albert Camus ist eine weitere Einsicht hilfreich: „Alles was ich über das Leben und die Moral weiß, verdanke ich dem Fußball“. Man muss sich nicht liebkosen, aber die Regeln einhalten. Wer sich nicht daran hält, dem sollen die Mitglieder die rote Karte zeigen.
Bildquelle: Pixabay, Bild von Gerd Altmann, Pixabay License