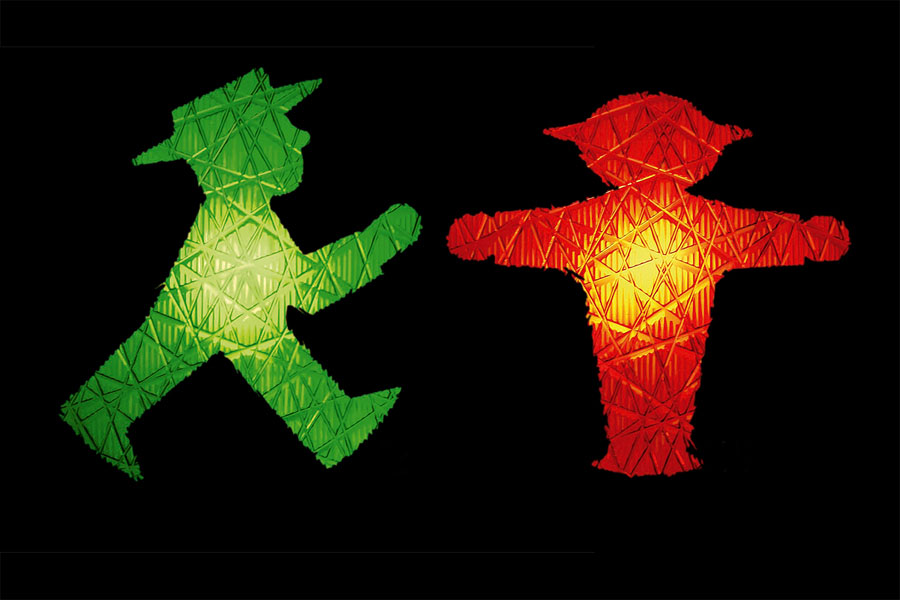Man reibt sich die Augen, wenn man darüber nachdenkt, wie die Grünen angefangen haben und wo sie heute stehen. Vor 40 Jahren wurden sie gegründet als eine Bewegung, die verhindern, die protestieren, aber nicht regieren wollte. Heute wären sie längst wieder in einer Regierung in Berlin, wenn nicht FDP-Chef Christian Lindner dies-die Bildung einer „Jamaika“Koalition- vor zwei Jahren mit seinem Auszug aus den Verhandlungen mit Merkel und der Grünen-Führung verhindert hätte. Und in bestimmten Medien wird über einen Grünen-Kanzler räsoniert. So schnell kann es gehen.
Ein Rückblick: 1004 Delegierte drängten sich am 13. Januar 1980 in die viel zu kleine Stadthalle von Karlsruhe. Man musste über das Gepäck und die Klamotten der Delegierten steigen, um in den Saal zu gelangen. 1004 stand für das Bohrloch von Gorleben, Symbol des Widerstands der Anti-Atombewegung. Ein einziger Stuhl war freigehalten worden,der für Rudi Dutschke. Der einstige Studentenführer hatte sich den Grünen angeschlossen, war aber am Heiligen Abend 1979, nur wenige Tage vor dem Kongress, an den Spätfolgen des Attentats von 1968 gestorben.
Vor 40 Jahren waren sie als Anti-Partei angetreten, die protestierte gegen das Establishment, die etablierten Parteien. Sie damals als „links“ einzustufen, das wäre noch untertrieben gewesen, zumal sie so eindeutig links, wenn man das mit den Schubladen mal so gelten lässt, auch wieder nicht waren. Denn in ihren Reihen befanden sich alle möglichen Vertreter von Links bis Rechts, von Anti-Atom bis Anti-Nato, Feministinnen, Punks, Künstler, alle die, für die in den Alt-Parteien kaum Platz gewesen wäre. Regierung, das war für sie etwas Abstoßendes, da wollten sie nicht mitmachen. Heute hat man eher den Eindruck, dass es ihnen nicht schnell genug gehen kann, wieder in die Bundesregierung zu gelangen, ja vielleicht sogar den Bundeskanzler zu stellen. Die Medien, die ihnen heute den Hof machen, wie z. b. die vornehme Hamburger Wochenzeitschrift „Die Zeit“, sahen sie damals nicht als politisch an. „Karlsruhe hat die Untauglichkeit der grünen Bewegung bewiesen.“ So der Kommentar in der „Zeit“ 1980. Aber auch andere Blätter urteilten hart: Der Gründungs-Parteitag der Grünen sei Klamauk gewesen, Tohuwabohu, Krimi, Karneval, aber keine Politik. Berichte über den Kongress wurden auf die bunte Seite gestellt, neben den Berichten über Unfälle und Überfälle. Die Öffentlichkeit schüttelte über die Neuen nur den Kopf, man nahm sie nicht für voll.
Als Willy Brandt die Arme öffnete
Dabei hatte sich das angebahnt und wer weiß, was aus der Studentenbewegung der 68er Jahre geworden wäre, wenn nicht Willy Brandt die Arme weit geöffnet hätte, um große Teile der Jugend in die SPD aufzunehmen, eine unruhige, eine gegen die Obrigkeit protestierende Jugend, die gegen den Vietnam-Krieg der Amerikaner auf die Straßen ging, die Fragen stellte nach der deutschen Vergangenheit, die wissen wollte, wie es zur Diktatur der Nazis gekommen war, warum ihre Eltern, Lehrer und Vorgesetzte sich nicht dagegen aufgelehnt hatten, warum sie zugeschaut oder gar mitgemacht hatten, als die Nazis Millionen Juden vergasen ließen. Aber es war mehr dahinter, man gab sich mit einfachen Antworten zur Energie-Sicherung nicht mehr zufrieden, sondern malte die Apokalypse an die Wand, den Atomtod, die nicht beherrschbare Atomenergie und die völlig unklare Frage der Entsorgung atomaren Mülls.
Die Älteren, die dabei waren, werden sich erinnern. „Von Gruhl bis Dutschke“, hieß ein Motto, unter dem sich Rote, Bunte und Graue im badischen Ländle versammelten. Herbert Gruhl war ein CDU-Bundestagsabgeordneter, der sich als Autor des Buches „Ein Planet wird geplündert“ einen Namen gemacht hatte. Und dieser Gruhl sprach die Begrüßungsworte auf dem Gründungskongress. Also begann er, wie er das vom Bundestag und von Parteitagen seiner CDU kannte mit den Worten: „Meine Damen und Herren“, weiter kam er nicht, weil ihn das Präsidium der Tagung belehrte: „Liebe Freundinnen und Freunde“, heiße das hier. Und Herbert Gruhl tat, wie ihm geheißen: „Liebe Freundinnen und Freunde unserer grünen Bewegung.“
Vor ihm saßen die 1004-wahrscheinlich waren es mehr-Versammelte. In dem Durcheinander war es nicht einfach, sich einen Überblick zu verschaffen. Alle redeten irgendwann dazwischen, riefen, schrien, meldeten sich zu Wort: Kommunisten, Bürger-Aktivisten, Vertreter der Anti-Atom-Bewegung, die Nato-Gegner, Punks saßen neben Schlipsträgern-ja die gab es-, Konservative hatten sich neben Gewerkschaftern platziert, Umweltfreunde waren dabei, Vertreter, die die deutsche Scholle verehrten, Frauenrechtlerinnen, katholische Entwicklungsgruppen. Es fehlte nicht an bekannten Namen, der Künstler Joseph Beuys war da, der Dissident Rudolf Bahro, der im DDR-Gefängnis Bautzen gesessen hatte, der DDR-Philosoph Wolfgang Harich, Petra Kelly, Otto Schily, der später zur SPD wechselte und Bundesinnenminister im ersten rot-grünen Kabinett von Gerhard Schröder wurde, der Ökobauer Baldur Springmann in einem bunten Russenkittel. Jochka Fischer stieß erst später zu den Grünen.
Die Zeit schien günstig für die Neuen
Die Zeit für eine Neugründung einer Partei schien 1980 auch deshalb günstig, weil die Russen 1979 in Afghanistan einmarschiert waren und die Nato ihren umstrittenen Doppelbeschluss zur Nachrüstung verkündet hatte. Pershing-Raketen als Antwort auf die SS 20-Raketen. August Haußleiter, ein Erzkonservativer aus Nürnberg, donnerte ins Publikum: „Wir erleben in diesem Augenblick den Aufmarsch, das Vorstadium zum dritten Weltkrieg.“
Im Saal herrschte Rauchverbot, stattdessen wurde überall gestrickt, was aber das Chaos im Saal nicht beseitigen konnte, weil gedroht und geschrien wurde, jeder wollte sich irgendwie bemerkbar machen. Dann plötzlich zogen 264 nichtberechtigte Delegierte in den Saal, sie wollten mitwirken, worüber dann ebenso diskutiert wurde wie über die Doppelmitgliedschaft. Man beschloss die Rotation und das Verbot von Ämterhäufung. Unzählige Anträge wurden gestellt, nicht behandelt, abgelehnt. Es war alles anders als bei den Parteitagen von CDU, CSU, der SPD oder der FDP. Ein namenloser Delegierter forderte zum Beispiel: „Mindestens ein Viertel der Kandidaten sollen solche Frauen und Männer sein, die eigenhändig Kinder großgezogen haben und nicht unglücklich gemacht haben:“ Der Antrag kam nicht zur Abstimmung.
Minderjährige Angehörige einer illegalen „Indianerkommune“ in rot gefärbten Haaren verlangten die Abschaffung der Schulpflicht, freie Liebe und das Recht, ab dem Alter von 12 Jahren zu Hause ausziehen zu dürfen. Einem Delegierten ging der tumultartige Parteitag auf die Nerven: „Ich fürchte, dass selbst die gewaltfreiesten Mitglieder der Versammlung nach und nach zur Flasche greifen, wenn noch viele Geschäftsordnungsanträge gestellt werden.“
Gegen Ende stoppte ein Witzbold heimlich die große Saaluhr, um zu verhindern, dass Delegierte voreilig zu den Zügen eilten. Denn die Zeit drängte, man kam nicht voran, aber die meisten Delegierten mussten noch am Abend nach Hause fahren, weil sie am nächsten Morgen wieder arbeiten mussten. Der letzte Zug fuhr um 17.56 Uhr Richtung Norddeutschland. „Zum Bahnhof brauchen wir 20 Minuten“, riefen Delegierte ins Mikrophon, man möge sich bitte beeilen, unter den Delegierten gebe es auch Gehbehinderte. Es wurde per Hand abgestimmt. Ergebnis: Zwei-Drittel-Mehrheit geschafft, Inhalte wurden auf den nächsten Parteitag verschoben. Man lag sich in den Armen und skandierte: „Weg mit dem Atomprogramm.“
1983 Einzug in den Bundestag
1983 schaffen die Grünen erstmals den Einzug in den deutschen Bundestag, mit Blumen, 1985 kommt es unter dem SPD-Ministerpräsidenten Holger Börner(er hatte den Grünen vorher mit der Dachlatte gedroht) zur ersten rot-grünen Regierung in Hessen. Joschka Fischer wird Minister, in Jeans und Turnschuhen wird er vereidigt. 1998 wird die erste rot-grüne Bundesregierung mit Schröder und Fischer gebildet, 2005 werden sie abgewählt. Aber es gelingt den Grünen, der CDU ihr Stammland Baden-Württemberg abzunehmen, Winfried Kretschmann wird der erste Grünen-Ministerpräsident. Auch auf lokaler Ebene haben sie Erfolge, Fritz Kuhn wird OB in Stuttgart, der Keimzelle von Daimler-Benz.
Und heute? Zugegeben, im Osten der Republik schwächeln sie, ausgerechnet da, wo die rechtsextreme AfD so viele Wähler gewonnen hat und die Grünen als stärkster Gegner der Neonazis, Faschisten, Rassisten und Fremdenfeinde anerkannt sind. Aber darüber hinaus sind sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sie haben die FDP verdrängt, längst die SPD, aus deren Fleisch viele von ihnen anfangs kamen, überholt. Bei der nächsten Bundestagswahl könnte es zur ersten schwarz-grünen Bundesregierung kommen, ausgeschlossen ist auch nicht ein grün-rot-rotes Bündnis, aber dafür müsste die SPD ihr Tief überwinden. Wie es scheint, kommt an den Grünen bei der Regierungsbildung keiner mehr vorbei. In elf Bundesländern regieren sie mit.
Die Klimabewegung scheint die Grünen in den politischen Himmel zu tragen, ihre Popularität ist weit ins bürgerliche Lager vorgedrungen, Gutverdiener und Gebildete zählen zu ihrer Klientel, akademisch, wirtschaftlich privilegiert, die Kirchen-Vertreter stehen ihnen nahe, Manager der Industrie zeigen sich gern an der Seite der Habecks und Baerbocks(pardon, umgekehrt heißt das bei den Grünen) oder laden sie zu ihren Kongressen. Sie definieren sich nicht mehr nur als Umweltfreunde, sie sind in der Außenpolitik anerkannt, in der Inneren Sicherheit genauso zu Hause wie in der Sozial- und Verteidigungspolitik. Sie sind auch keine Verbotspartei mehr, verbreiten gute Laune da, wo andere streiten, sie lächeln, wo andere verbiestert wirken. Mancher Kritiker sieht diese rasante Entwicklung skeptisch, zweifelt, dass der Aufschwung der Grünen anhält und fragt, wielange das noch gut gehen kann. Die Karikatur zum 40jährigen Feiertag der Grünen in der „Süddeutschen Zeitung“ zeigt die ganze Entwicklung der Partei nach, vom Protest des Fahnen schwenkenden Demonstranten bis zu den Akten tragenden Ministern. Und die Unterzeile besagt alles: Gemeinschaft der Heiligen.
Bildquelle: Pixabay, Bild von Susanne Jutzeler, suju-foto, Pixabay License