Christoph Hein hat sich seit Jahrzehnten den Ruf eines besonders emsigen Chronisten der DDR erworben, und dieser Erwartung wird der 80-Jährige gerade auch mit seinem Alterswerk „Das Narrenschiff“ wieder gerecht. Dies umso mehr, als der am Ende des Zweiten Weltkriegs in Schlesien geborene Pfarrerssohn den Bogen dieses Mal über die gesamte Periode des „Arbeiter- und Bauernstaats“ spannt, von der Gründung bis zur Implosion, und natürlich ist es – da bleibt sich Christoph Hein treu – keine kalte Abrechnung mit einem System, das seine Bürger unterdrückte, sondern ein eher altersmildes Portrait einer Gesellschaft von Gutgläubigen, Angepassten und Verdrängern. Die DDR war in diesem Sinne kein Land von Verbrechern, sondern ein „Käfig voller Narren“, wie es schon im Buchtitel gleichsam programmatisch anklingt. Da gehörten Kompromisse und „krumme Wege“ zur Normalität.
Folglich beschreibt Hein die Chronologie der DDR entlang den Biographien von Personen, die wohl typisch waren für die Verhältnisse jenes untergegangenen Staats, der sich anfangs dem antifaschistischen Frieden und dem demokratischen Sozialismus verpflichtet fühlte, aber von diesem ideologischen Pfad vermeintlicher Gerechtigkeit und internationaler Solidarität zusehends abwich. Der Autor hält sich strikt an sein Diktum, seine Protagonisten bloß zu beschreiben, um sie selbst zu verstehen und seinem Publikum zu erklären:“Ich bin nicht ihr Ankläger oder Verteidiger, und schon gar nicht ihr Richter.“ Dabei hält sich Hein an reale Vorbilder, an Menschen, die ihm wirklich begegnet sind, der prominenteste von ihnen ist Markus „Mischa“ Wolf, der legendäre Chef des DDR-Auslandsgeheimdienstes, im Buch tritt er als „Markus Fuchs“ auf.
Über 751 Seiten kommt Hein tatsächlich auch weitgehend ohne erhobenen Zeigefinger aus, wenngleich bei manchen etwas hölzern klingenden Dialogen der didaktische Subtext erkennbar mitschwingt. Und das Buch liefert jede Menge Lese- und Lernstoff zumal für Generationen, die erst nach der Wende von 1989 zur Welt gekommen sind, also mit den privaten wie gesellschaftlichen Zwängen und Verrenkungen der Ostdeutschen nicht vertraut sein können. Aber selbst für Leser, die glauben, die Geschichte der DDR gut zu kennen, bietet Hein überraschende Erkenntnisse an. So soll der erste Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht noch bis 1951 starr an seinem Anspruch auf ehemalige deutsche Ostgebiete in Schlesien und Pommern festgehalten haben, ehe Stalin ein Machtwort sprach. Und den Übergang von Ulbricht auf Erich Honecker schildert Hein als Putsch, nicht als friedlichen Stabwechsel nach überkommener Lesart der SED-Propaganda.
Christoph Hein hat überhaupt ein sehr selbstbewusstes Verhältnis zur Zunft der Historiker, denen er zwar zubilligt, sich mit „den Hinterlassenschaften von Geschichte zu beschäftigen“, doch es seien die Romanciers wie Homer, Tolstoi oder Dostojewski, die „Geschichte erzählen“, also den wahren Verlauf von Ereignissen abbilden. Insofern werden die Historiker nicht umhin kommen, sich über Heins Erzählung zu beugen und noch einmal nachzuprüfen, was es mit Ulbrichts Gebietsansprüchen und Honeckers Staatsstreich auf sich hatte. Hein jedenfalls beruft sich auf glaubwürdige Quellen, nachprüfbare Dokumente und nicht zuletzt auf den berufenen Zeitzeugen Markus Wolf, der keinen Grund gehabt habe, dem Schriftsteller nicht die Wahrheit zu sagen:“Ich konnte ihm ja in keiner Weise schaden oder nützen.“
Einblicke anderer, aber nicht weniger aufschlussreicher Art erlauben die übrigen Personen, die Hein über weite Strecken des Romans beobachtet. Der Ökonomie-Professor Karsten Emser zum Beispiel, Mitglied des ZK der SED, der bei Kriegsende aus dem Moskauer Exil nach Ost-Berlin entsandt wird, um die DDR mitzugründen, ist ein Vertreter der obersten Funktionärsschicht, der voller Enthusiasmus ans Werk geht, loyal und klug, am Ende aber erkennen muss, dass er einer Illusion verfallen ist, die Wirklichkeit verleugnet, seinen Idealen alles geopfert hat. „Ich schwieg zu oft, Rita“, so beichtet er in einem Moment größtmöglicher Selbstkritik seiner Frau, der Stellvertreterin des Bürgermeisters aus dem Roten Rathaus,“deshalb bin ich schuldig. Ich schwieg aus Angst, aus Feigheit, aus Furcht um mein Leben.“ Zu spät hatte dieser gebildete Repräsentant der ostdeutschen Nomenklatura einst erkannt, welche Verbrechen Stalin in der Sowjetunion zu verantworten hatte, zu spät sieht er ein, dass auch ein aufrechter Kommunist wie er die DDR nicht guten Gewissens von ihren inneren Widersprüchen reinwaschen kann – von Schikanen, Opportunismus, Günstlingswirtschaft. Schonungslos ehrlich wird Ulbrichts Devise auf den Punkt gebracht:“Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“
Dagegen hält der Ex-Nazi und Wehrmachtssoldat Johannes Goretzka bis zum Schluss an seinem Glauben an die Obrigkeit fest, ein Wendehals reinsten Wassers, obwohl ihn der Staat in seinem Karrierestreben rücksichtslos demütigte. Kaum zu glauben, dass ausgerechnet dieser unsympathische Mann Züge von Heins Schwiegervater trägt, dem Stiefvater seiner ersten Ehefrau Christiane, die als „Kathinka Lebinski“ ebenfalls eine Rolle im „Narrenschiff“ spielt und sich sehr zum Verdruss von Johannes Goretzka ausgerechnet einen Pfarrerssohn (sic!) und Regimekritiker zum Gatten wählt. Trotz der charakterlichen Defizite des notorischen Mitläufers Goretzka enthält sich Hein auch in diesem Fall einer moralischen Verdammnis, schon gar nicht blickt er missbilligend auf die Seitensprünge von Goretzkas Ehefrau Yvonne, die sich zur Kulturhausleiterin und Führungskraft bei der staatlichen Hauptverwaltung Film hocharbeitet und von ihrem verhassten Mann, den sie einst „aus Versorgungsgründen“ geheiratet hatte, beruflich wie emotional emanzipiert.
Schließlich erscheint der Anglist und Germanist Benaja Kuckuck auf der Bühne, ein jüdischer Shakespeare-Experte, der eine akademische Karriere in seinem englischen Exil bewusst gegen die Rückkehr in seine Heimat eintauscht, um dort allerdings zu einem freudlosen Dasein als Kultur-Funktionär in einem fachfremden Ressort verurteilt zu werden. Der (zunächst versteckt) Homosexuelle und Freigeist, der an den berühmten Literaturwissenschaftler Hans Mayer erinnert, arrangiert sich mit dem SED-Staat allein aus pragmatischen Gründen:“Ich bin ja nicht nur ein dialektischer Materialist, sondern auch ein ganz hedonistischer. Meinen Lebensstandard möchte ich nicht aufgeben, dafür bin ich einfach zu alt.“ Seinen intellektuellen Spott lässt sich Kuckuck freilich nicht nehmen, treibt es aber nicht so weit, dass er sich selbst oder seine Freunde in Gefahr bringt.
Man kann Christoph Hein trotz seiner kritischen Anmerkungen über ein insgesamt diktatorisches Regime vorwerfen, die DDR in einem zu freundlichen Licht zu spiegeln. Doch das übersieht, dass sich der Autor in erster Linie mit den menschlichen Schicksalen einer ostdeutschen Bevölkerung befasst, deren Lebensentwürfe und Träume mit Intrigen und Verstrickungen kollidierten, die systembedingt waren. Die Menschen in ihrem Alltag wurden meist unfreiwillig zur Besatzung jenes „Narrenschiffs“, von dem Christoph Hein mit feiner Ironie schreibt. Das Schiff fährt am Ende auf Grund, aber die neue Wirklichkeit der Ostdeutschen ist keineswegs eine Gesellschaft ohne Fehl und Tadel, keine „blühende Landschaft“, sondern ein „Staat, in dem das Grundbuch wichtiger ist als das Grundgesetz“, wie Hein sagt. Die komplette Abwicklung von DDR-Unternehmen war in seinen Augen ebenso fatal wie der Rausschmiss zahlreicher Universitätsprofessoren oder das Motto „Rückgabe vor Entschädigung“ beim Umgang mit Häusern und Grundstücken.
Kein Wunder, dass für den preisgekrönten Schriftsteller, der bei Leipzig aufwuchs und heute in Brandenburg lebt, der demokratische Sozialismus unverändert „als Wunsch und Traum von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“ existiert, „von einer Gesellschaft, die nicht allein dem Kapital verpflichtet ist“. Das sind für Christoph Hein „uralte Menschheitsträume, festgeschrieben im Neuen Testament, in der Bergpredigt“. Zum Aktivismus neigt er nicht, deshalb beteiligt er sich auch nicht an irgendwelchen Appellen oder Petitionen, schließlich sei er „Schriftsteller und kein Unterschriftsteller“. Stattdessen hängt er lieber seinen „christlich-sozialistischen Ideen“ an: “Man kann doch träumen, man sollte träumen.“
Christoph Hein: Das Narrenschiff. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 751 Seiten. 28 Euro.

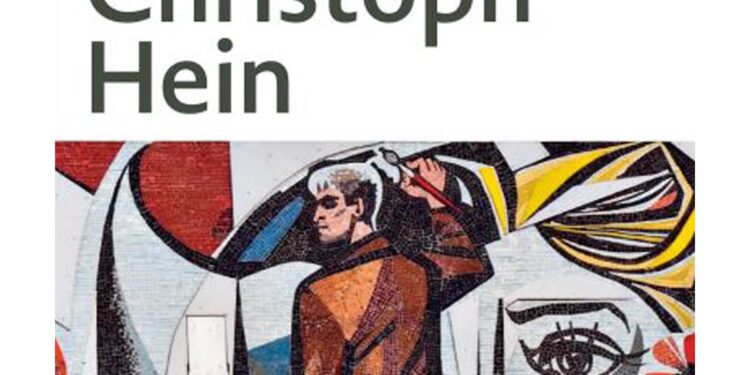














 Unser Blog lebt durch Sie!
Unser Blog lebt durch Sie!