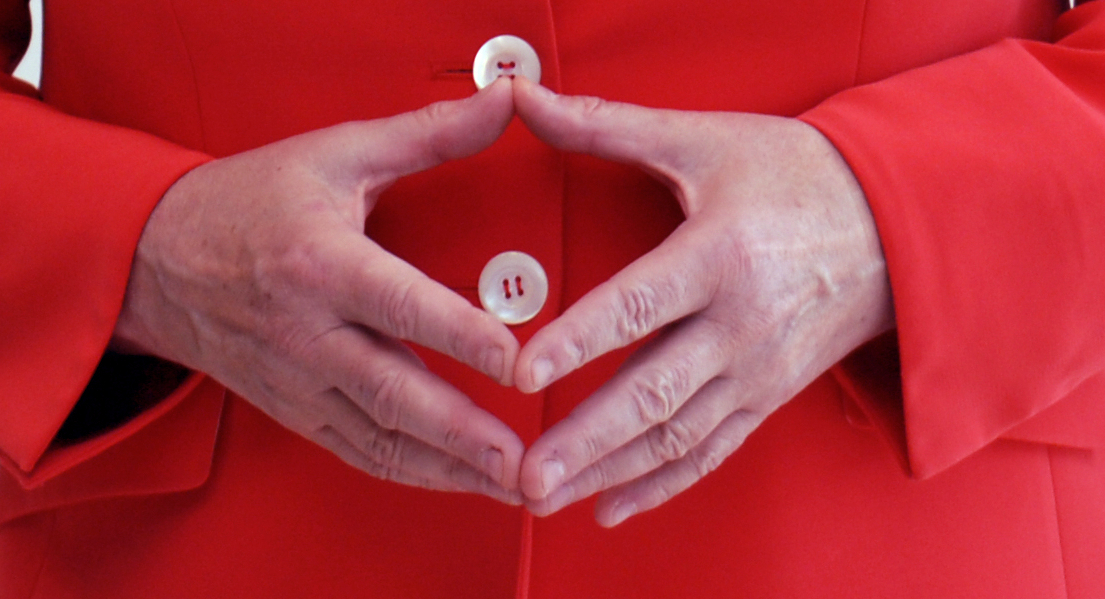Epizentrum der Pandemie-Bekämpfung, erste Adresse für prominente Patienten aus aller Welt, Kaderschmiede von Spitzenmedizinern, Schauplatz einer populären TV-Serie – die Berliner Charité, größte Uni-Klinik des Kontinents, macht immer wieder Schlagzeilen. Mal meldet sich Top-Virologe Christian Drosten mit Warnungen vor der nächsten Corona-Welle zu Wort, mal wird Kreml-Kritiker Alexej Nawalny von Spezialisten des Hospitals an der Spree entgiftet, mal lässt sich das Fernsehpublikum von der dritten Staffel der Krankenhaus-Saga unterhalten. Die berühmte Heil- und Forschungsanstalt im Herzen der Hauptstadt rangiert nach dem Urteil von Experten auf Platz 1 in Deutschland und gilt laut US-Magazin Newsweek als Nr. 5 der Welt.
3000 Betten, 19 000 Mitarbeiter, über 800 000 Patienten pro Jahr, die ambulant und stationär von 11 000 Ärzten behandelt werden: Das 1710 von Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. als Seuchenlazarett vor dem Oranienburger Tor gegründete „Haus der Barmherzigkeit“ hat sich längst über die ganze Stadt ausgebreitet und ist inzwischen an vier Standorten beheimatet: Am Gründungsort in Mitte, am Virchow-Campus im Wedding, am Klinikum „Benjamin Franklin“ in Steglitz und am Max-Delbrück-Forschungszentrum in Buch. Die Charité ist zugleich die medizinische Fakultät der Humboldt Universität, an der 7500 Human- und Zahnmediziner studieren. Eine riesengroße Heilfabrik.
Derzeit versorgt das traditionsreiche Krankenhaus auf vier Stationen alle Berliner Covid-19-Fälle mit besonders schweren Verläufen. Jüngst zeigte die ARD eine 45-Minuten-Dokumentation aus dem „Level-1-Zentrum“ der Charité, den dramatischen Kampf von Ärzten und Pflegerinnen um das Überleben ihrer Patienten auf der Intensivstation. Hier allein liegen bis zu 160 Menschen, die an Beatmungsmaschinen angeschlossen werden. Das Personal stößt immer wieder an Belastungsgrenzen, Mangel an Fachkräften herrscht seit Jahren. Unterdessen arbeiten seit dem vergangenen Herbst mehr als 50 ehemalige Flugbegleiterinnen im Pflegedienst des Klinikums, die bei ihren Linien nicht mehr gebraucht werden. „Im Idealfall“, so sagt Martin Kreis, im Vorstand des landeseigenen Unternehmens für die Krankenversorgung zuständig,“beginnen sie eine Ausbildung bei uns im Haus.“
Den guten Ruf als eine der besten Uni-Kliniken der Welt hat sich die Charité über Jahrhunderte erworben. Nach der Gründungsphase als Berliner Pestlazarett wuchs das Krankenhaus rasch zur Heilanstalt der preußischen Armee heran. König Friedrich Wilhelm I. hatte nicht bloß viele Soldaten und Kanonen unter seinem Kommando, er brauchte in Kriegszeiten auch jede Menge Ärzte und Chirurgen, und er war immerhin so weitsichtig, in die medizinische Grundlagenforschung sowie in die Ausbildung von Medizinern und Krankenschwestern zu investieren. Das war die Basis für den Aufstieg der Charité. Kein Wunder, dass hier Koryphäen wie die Nobelpreisträger Robert Koch, Rudolf Virchow, Paul Ehrlich und Ferdinand Sauerbruch lehrten, forschten und praktizierten, und dass sich während der Weimarer Republik, im Dritten Reich sowie zu DDR-Zeiten gern auch die politische Elite einquartierte.
Noch heute wird im Pathologischen Institut der perforierte Blinddarm von Reichspräsident Friedrich Ebert aufbewahrt, an dem der Sozialdemokrat 1925 plötzlich verstorben war. Namhafte Patienten der Gegenwart waren neben dem russischen Oppositionellen Nawalny auch Ex-Präsident Boris Jelzin, die zeitweilige Ministerpräsidentin der Ukraine, Julia Timoschenko, bekannte oder berüchtigte Militärs, Diktatoren und Minister aus Osteuropa, Zentralasien und Nordafrika, die auf Diskretion und bewaffneten Personenschutz bedacht waren. Nicht zuletzt bundesdeutsche Politprominenz wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sowie Ex-Außenminister Sigmar Gabriel vertraute sich den heilenden Händen der Ärzte im Regierungsviertel an.
Die ebenso glorreiche wie wechselvolle Geschichte der Charité hat das Fernsehen zu einer üppigen Serie inspiriert, deren dritte Staffel im Januar lief. Gedreht wurde übrigens nicht am Originalschauplatz, der backsteinernen „Stadt in der Stadt“ auf dem Campus in Mitte, sondern in Prag und Umgebung. Im Brennpunkt stand dieses Mal die Geschichte des Klinikums im Kalten Krieg. Der DDR war das Krankenhaus unmittelbar am Todesstreifen, der Berlin von 1961 bis 1989 teilte, als Vorzeige-Einrichtung für die Leistungsfähigkeit des Arbeiter- und Bauernstaates lieb und teuer. Der aus Österreich stammende Forensiker Otto Prokop und das jüdische Mediziner-Ehepaar Mitja und Ingeborg Rapoport verliehen der Heilstätte internationales Renommé. Ideen für eine vierte Staffel gibt es bereits. Dann soll der Blick weit in die Zukunft gehen, in die Mitte des 21. Jahrhunderts.
Für diese Zeit schmiedet auch die Politik fleißig Pläne. Wollte der frühere Bürgermeister Klaus Wowereit das Großklinikum noch in seine Einzelteile zerschlagen, geht sein Nachfolger Michael Müller den umgekehrten Weg. Die Charité soll wachsen und Berlins Markenzeichen als Medizinmetropole mit globaler Ausstrahlung stärken. Das will sich der Senat immerhin 6,6 Milliarden Euro bis zum Jahr 2050 kosten lassen. Neben dem schon existierenden Herzzentrum auf dem Virchow-Campus soll ein nationales Tumorzentrum entstehen, für das die Stadt vor ein paar Monaten den Zuschlag erhielt. Der 82 Meter hohe Bettenturm in Mitte könnte künftig von zwei weiteren Hochhäusern flankiert werden. Das freilich bleibt vorerst Zukunftsmusik. Akut gilt die Konzentration der dritten Corona-Welle. Charité-Chef Professor Heyo Kroemer will die gegenwärtige Krise mit den vorhandenen Mitteln meistern. Danach aber fordert er Konsequenzen aus der Pandemie, einen Notfall-Plan:“Die Krankenhäuser brauchen Reserven, also Kapazitäten für Großereignisse wie Epidemien.“
Erstveröffentlicht im Badischen Tagblatt am 20.3.2021
Bildquelle: Elisauer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons