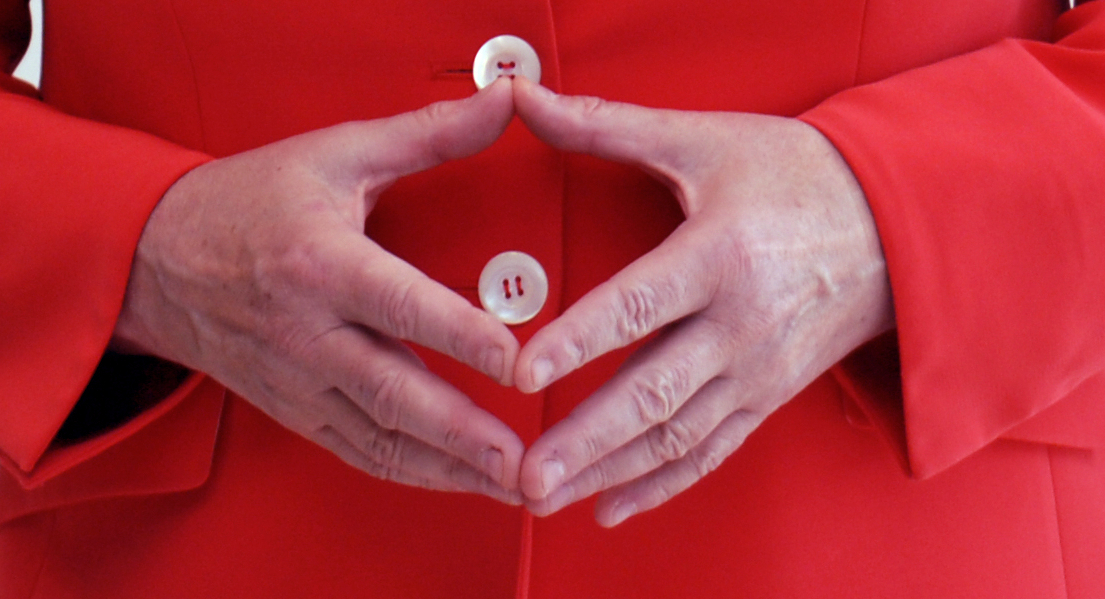Kurz nach dem Ersten Weltkrieg und damit auch in den Wirren der ersten Jahre nach der russischen Oktoberrevolution hatte der junge Brite Gerhardie, der als Captain bei der britischen Militärmission in Sibirien war, an seinem Studienort Oxford mit der Niederschrift seines Debütromans begonnen. Erschienen ist er 1922 und fand gleich große Beachtung, auch wenn der Erfolg sich nicht in hohen Auflagen und Verkaufszahlen niederschlug. Vergeblichkeit hatte die literarische Welt in Staunen versetzt, und nun war diese Welt vor lauter Bewunderung stumm, heißt es im Nachwort. Gerhardies Werk, in das eigene Erlebnisse aus der Kriegszeit einfließen, wird immerhin in Verbindung mit Gontscharows Oblomow gebracht, und man staunt über die sichere Hand, die allen Witz, alles Pathos, alle Ironie dieser zugleich dichten wie ausufernden Erzählung zusammengehalten und sie entschlossen zu einem unausweichlichen Abschluß geführt hat – so die begeisterte amerikanische Schriftstellerin Edith Wharton, die Michael Holroyd im Nachwort zitiert. Er selbst hebt noch auf einen interessanten Aspekt ab, nämlich auf das moderne Motiv des Wartens, das hier erstmals in der englischen Literatur auftaucht und erst viele Jahre später von Beckett wieder aufgegriffen werden sollte. Bei Gerhardie steht das Warten und die Vergeblichkeit desselben in mehrfacher Beziehung zu seinen Hauptfiguren: Der für wohlhabend angesehene Familienvater wartet auf die behördliche Klärung seiner Besitz- und Vermögensverhältnisse – und dies vergeblich; der sich immer mehr erweiternde Kreis von Angehörigen und vermeintlich Zuwendungsberechtigten wartet auf die finanzielle und rechtliche Absicherung – auch dies vergeblich; und schließlich der Erzähler, ein Freund und Vertrauter der Familie, wartet auf die Erwiderung seiner Liebe zu Nina, einer der drei Töchter – abermals vergeblich. Und nicht zuletzt wird die Haltung, die das Warten allgemein erfordert – und dazu gehört zumindest Geduld, wenn nicht eine gewisse Schicksalsergebenheit und Unterwürfigkeit – mit feiner Ironie problematisiert. Auch die titelgebende Vergeblichkeit hat hier – neben der persönlich-familiären – durchaus eine gesellschaftlich-politische Konnotation: zumindest in konservativen Kreisen der Alliierten Intervention, hier verkörpert durch einen britischen General, hält man überhaupt nichts vom Bolschewismus und die ganze politische Situation für ein Abenteuer in Vergeblichkeit.
Es handelt sich also nicht um ein Stück russischer Literatur, sondern um einen Roman über russische Verhältnisse in der nachrevolutionären Epoche aus der Sicht eines in diese Verhältnisse selbst eingedrungenen britischen Autors – eine Sicht „von außen“, aber eine interessante Spiegelung, die manchmal einen tieferen Einblick in die Verhältnisse gestattet, als wenn man als Einheimischer der Gesellschaft angehört.
Es besticht zunächst einmal die Roman-Konstruktion, allein schon die des ersten Kapitels, das sich der Familie Bursanow widmet. Im Zentrum steht Nicolaj Wasiljewitsch B., der Vater, dem der Besitz eines Stadthauses und eines Bergwerks mit Goldmine, also ein beträchtliches Vermögen nachgesagt wird; er ist verheiratet mit Magda Nicolajewna B., die ihm aber davongelaufen ist, um sich mit dem jüdischen Zahnarzt Eisenstein zusammenzutun. Er ist der Vater von Vera, mit Nicolaj hat Magda die Töchter Sonja und Nina. Alle drei Töchter leben aber nicht bei der Mutter, sondern bei der deutschstämmigen Immigrantin Fanny Iwanowna, die mit Nicolaj liiert ist, die drei Mädchen großgezogen und sich für die Familie aufgeopfert hat, so jedenfalls sieht sie es.
In Bewegung kommt diese Konstellation immer wieder durch die Scheidungsfrage und mit ihr die diversen Interessenlagen: Nicolaj W. will einerseits die Scheidung von Magda, um Fanny zu ehelichen und seine Verpflichtungen ihrer Familie gegenüber zu legalisieren; andererseits will er die Scheidung nicht, um die Töchter nicht zu verlieren, aber auch um Fanny nicht heiraten zu müssen, denn er will eigentlich nicht Fanny, sondern die 17jährige Zina ehelichen, bei der er schon eine geraume Zeit seines Lebens verbringt; dafür will er nun wiederum die Scheidung von Magda, gegen die jetzt aber Fanny rebelliert. Man könnte meinen, Nicolaj sei in eine neue Beziehung (mit einer jungen Frau im Alter seiner Töchter) geflüchtet, um die vielfältigen Belastungen und Verpflichtungen abzuschütteln, denen er bisher nachzukommen hatte; doch stattdessen haben sich diese immer mehr vergrößert und erweitert: Nicolaj versorgt nicht nur seine Ehefrau Magda (und damit auch deren Geliebten Eisenstein), Fanny und ihre Familie in Deutschland, die drei Töchter sowie seit Jahren schon den im Stummheit verfallenen alten Fürsten Knjas, der quasi zur Familie gehört – hinzugekommen sind Unterhaltsansprüche von Zina und ihrer verzweigten Familie. Zu guter Letzt ist Magda dem Zahnarzt weggelaufen und will die Scheidung von Nicolaj, die nun aber Fanny verweigert, weil sie, nachdem ihre Lebensleistung (3 Töchter von N. großgezogen) nicht anerkannt wurde, einen reichen Österreicher namens Cecedek heiraten und Magda nicht aus der Verantwortung für Nicolaj entlassen will.
Bei all diesen Verwicklungen, Anhänglichkeiten und Abhängigkeiten, Verpflichtungen und Anspruchshaltungen, einer Versorgungsmentalität, die den Versorger nur überfordern kann, denkt man unweigerlich an eine Komödie oder ein Drama in der Literatur. Und der Erzähler Andrej Andrejewitsch, der, durch häufige Besuche nahe dran am Geschehen, glaubt, die Familie gut zu kennen, vergleicht dieses (wirkliche) Leben in der Tat mit dem Theater, wenn er zu der Einschätzung gelangt, das Leben der Bursanows sei eine Farce.
Das erste Kapitel heißt Die drei Schwestern, und sie werden auch in ihren Neigungen und Besonderheiten ausgiebig vorgestellt. Der Titel nimmt aber auch Bezug auf Tschechows gleichnamiges Drama. Die Familie geht ins Theater, um sich genau dieses Stück anzusehen; zwar sind weder die Töchter noch Fanny sonderlich berührt davon, umso mehr jedoch weiß Nicolaj W. die Tschechowschen Dramen in ihrem Realismus zu schätzen, denn – so seine Überzeugung – sie erfassen die Wirrungen des Lebens, ganz so, wie das seine verworren ist.
In dieser weitverzweigten Familie existieren Kommunikationsstörungen der besonderen Art: die Angehörigen der verschiedenen Gruppen verhalten sich unter- und gegeneinander ignorant bis feindlich, man redet nicht miteinander, hegt seine Anschauungen voneinander, gespickt mit einer guten Portion Argwohn, Neid und Missgunst. Jede Person sieht sich im Unrecht und fühlt sich den anderen gegenüber benachteiligt. Doch irgendwie gelingt es immer wieder zusammenzubleiben und – sofern von außen das Gefüge in irgendeiner Weise bedroht erscheint – sogar zusammenzuhalten. Dies bekommt ausgerechnet der Erzähler Andrej zu spüren, als er einmal den Versuch unternahm, vermittelnd und konfliktlösend in die familiären Angelegenheiten einzuwirken. Von allen Seiten, am vehementesten jedoch von der angebeteten Nina, wird er zurechtgewiesen mit dem Argument, dass ihn die Auseinandersetzungen in der Familie nichts angingen und er sich gefälligst heraushalten solle.
Zusammengehalten wird der Clan über die jeweiligen Beziehungen zu Nicolaj W., also vermittels materieller Interessen und der Erwartung, dass sie sich in Form einer lebenslangen Versorgung realisieren. Einem wandelnden Gravitationsfeld gleich folgt der gesamte Tross seinem Ernährer auf Schritt und Tritt – von der Hauptstadt ins ferne Sibirien, dann nach Omsk, wo Nicolaj seine Besitzansprüche auf das Bergwerk gegenüber den Enteignern in der bolschewistischen Bürokratie geltend machen will, und wieder zurück nach Wladiwostok.
Es ist, als ob Gerhardie in dieser Familie die ganze russische Gesellschaft (mit ihren rivalisierenden Gruppierungen, Schichten und Klassen) abbildet und Nicolaj dabei die Rolle des Väterchens Staat zuspricht. Der ironische Stil verstärkt den Eindruck der Parodie. Auch die zentrale Eigenschaft dieser Familie, nämlich in Starre und Unveränderlichkeit zu verharren, hat einen gesellschaftlichen Bezug. Dass man hier unter dem Motiv des Wartens und Verharrens in Lethargie selbst noch auf den Beginn des Lebens wartet, sei am Beispiel von Fanny I. mit diesem Zitat belegt:
Fanny Iwanowna, in stummem Nachsinnen über ihre Handarbeit gebeugt, und der Knjas in seinem gewohnten Sessel, lesend oder, öfter noch, müßig dasitzend und dösend. Die Jahreszeiten mochten rasch von einer zur andern wechseln – aber ihre Positur wechselte nie! … ‚Wie ermüdend das alles ist, Andrej Andrejewitsch!‘ klagte Fanny Iwanowna. ‚Ewig darauf warten, daß man endlich zu leben anfängt! Wann wird es endlich beginnen, die Wendung zum Glück und das herrliche Leben, auf das wir alle warten? Da wartet man auf den Frühling. Aber der Frühling kommt, kommt wieder mit leeren Händen und betont nur – durch den Gegensatz – unser Elend. Der Frühling macht mich verrückt. Ich fange an, mir Unmögliches zu wünschen…‘ ‚Sie sind ein aktiver Mensch, Fanny Iwanowna. Sie sollten nicht stillsitzen. Es ist nicht gut für Sie. Sie sollten herumlaufen.‘ ‚Aber – ich muß doch warten.‘ ‚Warten ist vermutlich Stillesitzen. Doch, irgendwie ist es das.‘
Die Szene grenzt ans Absurde, und mit der Zuspitzung des Wartens auf das Leben selbst, das für Fanny I. noch nicht begonnen haben soll, hat der Roman hier Elemente des absurden Theaters aufgegriffen bzw. vorweggenommen. Doch wenn das Lebensgefühl der Frau eines der Lähmung, der Paralyse ist, dann geht der gutgemeinte Rat des Ich-Erzählers, sie solle sich mehr bewegen in Sinne von umherlaufen, in die Irre; denn wenn, dann ist Fanny I. von einer sozialen Krankheit befallen und nicht so sehr von physischer Erstarrung oder Faulheit.
Immer wieder stößt man auf Stellen, die auf so etwas wie eine russische Mentalität verweisen; das ist, wie eingangs bemerkt, wegen der Außensicht des Autors von besonderem Reiz. Da ist z.B. die Rede vom typischen Russen. Nicolaj N. bezeichnet sich selbst als einen: Ich bin selbst ein typischer Russe. Es gibt ehrliche Männer in Rußland, und es gibt gescheite Männer in Rußland, aber es gibt keine Männer in Rußland, die ehrlich und gescheit sind. Und falls sie es sind, dann sind es wahrscheinlich schwere Trinker.
Typisch soll es für Russen auch sein, dass ein ausgesprochenes Nein nicht unbedingt auch nein bedeutet, was nicht allein eine semantische Frage ist, sondern auf den Tatbestand der Beeinflussung bzw. Beeinflussbarkeit (Stichwort: Bestechung oder im milderen Fall Sinneswandel) des Neinsagenden abhebt. Der Admiral sagte immer noch ‚Nein‘. Er vertrat die Ansicht, dass es hier nicht um die menschliche Natur, sondern nur um die russische Natur ging, und um seinen Standpunkt klarzumachen, wollte er zeigen, daß ein Engländer, wenn er ‚Nein‘ sagt, auch wirklich ‚Nein‘ meint. Doch keiner von allen wollte verstehen, wie der Admiral ein ‚Nein‘ auslegte. Sie waren alle mit dem Gedanken groß geworden, daß ‚Nein‘ nach dem ausreichenden Maß an Drängen und Beharrlichkeit ‚Ja‘ bedeutet. Das Drängen war verschiedener Art, je nach Alter, Geschlecht und Charakter des Bittstellers.
Auch erfahren wir, dass der durchschnittliche Russe gerne dem Alkohol zuspricht und in der Trunkenheit seinen Gefühlen freien Lauf lässt: sei es sein Hang zur Schwermut, in der er glücklich ist, sei es, dass er dicht am Wasser gebaut ist und gerne weint oder sei es, dass er gerne feiert, lacht und tanzt, und alle sonst trennenden Umstände oder Abneigungen wie weggefegt sind – die weiche Seele nimmt Überhand selbst unter den verschiedenen „Flügeln“ des Clans, zum Beispiel anlässlich einer Dinner-Party, die Andrej A. für die ganze Sippe ausrichtet. Wir wurden aufgeregt. Wir sprachen alle gleichzeitig, vielleicht einzig aus dem Grund, weil wir so lange nicht sprechen durften. Und dann beruhigten wir uns plötzlich, denn im Stockwerk über uns … spielte jemand Klavier. Es war Chopin! Wir hörten auf die Musik und wurden still, und unsere Seele war ganz Musik, als hätte er ihre Saiten angerührt. Und das Haus schien verzaubert, und die rauhe sibirische Nacht schaute zu den Fenstern herein und lauschte stumm … Nicht umsonst spricht Gerhardie von Verzauberung, die gerade die Musik Chopins hier in Rußland auslösen kann – so ausgelassen sie waren, bei den Klängen dieser Musik verstummen alle, um ihr andächtig zu lauschen und sie direkt ins Herz aufzunehmen.
Nicht gerade den Durchschnittsrussen repräsentiert Zinas Onkel Kostja, seines Zeichens Schriftsteller, der vor lauter grüblerischem Nachdenken nicht so recht zum Schreiben kommt. Immer wieder verfällt er in Schwermut, Melancholie und Selbstzweifel. So sehr, dass man sich in Zinas Familie Sorgen um ihn macht und Andrej A. bittet, sich einmal mit ihm zu unterhalten. Die Unterredung verläuft schleppend, und unser Ich-Erzähler übt sich in Geduld. Dann spricht Onkel Kostja über die Vergeblichkeit des Schreibens: Ich habe an dies und das und weiß nicht was gedacht, tatsächlich an mancherlei – wertvolle, aber schwer faßbare Gedanken, Andrej Andrejewitsch. Herrlich Empfindungen! Ein Kaleidoskop der feinsten Farben, wenn ich mich so ausdrücken darf. Und es hat mich eine große Wahrheit gelehrt, Andrej Andrejewitsch: Es hat mich gelehrt, wie vergeblich alles Schreiben ist. Der Angesprochene ist bemüht, die Erkenntnis der Vergeblichkeit des Schreibens nicht gelten zu lassen, doch auch dies vergeblich. Onkel Kostja fährt fort: Und wenn ich bedenke, was für ein Dummkopf ich gewesen bin: all die Jahre habe ich geschrieben, geschuftet, mich wie ein Sklave am Schreibtisch abgerackert – anstatt nachzudenken, einzig und allein nachzudenken … Ich habe heute nachgedacht. Es wird Ihnen nichtig erscheinen, wenn ich es Ihnen sage; es wird mir nichtig erscheinen, wenn ich es sage; aber glauben Sie mir, im Moment, als ich es dachte, war es etwas unendlich Tiefes, unendlich Verwickeltes, unendlich Schönes – und ohne die Mühsal der Anstrengung. Doch um was es sich dabei gehandelt haben mag, war nicht zu erfahren; Onkel Kostja meint nur, es war unbestimmt und dass es ihm schwerfiele, „es“ zu konkretisieren, weil er zuviel weiß. Und dann entspinnt sich eine urkomische Rede und Gegenrede darüber, wohin wir alle gehen, warum wir uns alle bewegen, um Beweggründe und die Konsequenzen, um die Reise und ihre Vergeblichkeit – und das alles mit gewollten oder ungewollten Missverständnissen zwischen den Gesprächspartnern. Nahe der Verzweiflung ruft Onkel Kostja aus: Verstehen Sie denn nicht, dass es gerade diese physische Vergeblichkeit ist, die mich zu einem Gefühl geistiger Wichtigkeit aufbläht? Im Resultat läuft des Onkels Erkenntnis oder Bekenntnis darauf hinaus, dass die große Reise des Lebens nicht nur vergeblich, sondern der Inbegriff der Sinnlosigkeit ist und dass wir uns selber täuschen. Onkel Kostja entpuppt sich demnach als Nihilist – das ist das Resultat seines vielen Nachdenkens.
Der Roman fängt (in Gestalt weniger Figuren wie etwa des britischen Admirals) auch die sogenannte Alliierte Intervention ein, die ihren Hauptsitz in Sibirien hatte, um von dort aus organisatorische und administrative Aufgaben zu übernehmen. Diese fremden Mächte im eigenen Land dulden zu müssen, schien allseits – ob von den Roten oder Weißen – auf Ungnade und Unmut zu stoßen. Es gehört wesentlich zur Gastfreundschaft der Russen, daß sie einen ‚Alliierten‘ ins Gesicht als Lump behandeln, wegen gemeiner Machenschaften, die seine Regierung in auswärtigen Angelegenheiten praktiziert. Man verspürt die kulturelle Fremdheit, die einhergeht mit einem strukturellen Unverständnis für die Probleme im Land. Auch die ideologische Beschränktheit des Admirals stößt auf heftige Ablehnung, wie etwa sein Antisemitismus, gepaart mit Antibolschewismus.
‚Ihr Juden‘, sagte der Admiral, ‚seid allesamt verdammte Bolschewisten!‘ Wenn der Admiral von Juden sprach, war er wutentbrannt, und komischerweise nahm sein Gesicht dann gewisse semitische Züge an.
‚Ich war es nicht, Admiral‘, entgegnete Eisenstein. ‚Ich könnte jetzt einer werden. Dort könnte wenigsten ein Hoffnungsstrahl sein. Hier ist keine Hoffnung.‘
‚Ich war auch keiner‘, rief der Knjas, und seine Augen blitzten leidenschaftlich, ‚bis ihr Alliierten mich zu einem gemacht habt!‘
Welches Gewicht in der Aussage des alten Fürsten liegt, kann man nur ermessen, wenn man sie als erste nach zwanzigjährigem Verstummen registriert. So lange hatte der Alte sich Zeit zum Nachdenken genommen, und nun bekennt er sich, wie schon vor ihm im Gespräch der jüdische Zahnarzt, sogar zum Bolschewismus – jedoch mit der Einschränkung, dass nur die Einmischung von außen zu diesem Gesinnungswandel bei ihm geführt hat. Da fühlt man sich doch auch an den „Interventions“- Versuch in die zerstrittene Großfamilie Bursanov nebst Anhang erinnert, den Andrej A. unternommen hatte und von allen Seiten schroff in die Schranken verwiesen worden war. Nach ähnlichem Muster wird anscheinend mit der Alliierten Intervention verfahren: so konfliktorisch die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Schichten und Klassen zueinander stehen und sich gegenseitig bekämpfen – die Einmischung „von außen“ schmiegt sie zusammen, um sich gemeinsam gegen die Intervention zu wehren.
Es ist Gerhardie gelungen, mittels einer überschaubaren Zahl von Personen Typisierungen zu schaffen, die auf größere Populationen verweisen. Mit dem Ausschnitt seiner Familiengeschichte gelingt es ihm, einen Mikrokosmos der russischen Gesellschaft in einer bestimmten Epoche abzubilden und diesen umso lebendiger zu gestalten, als er mit Witz und Ironie, durch Überzeichnung und Fokussierung charakteristische Züge und Strukturen aufzeigt. Sein Faible für Anton Tschechow hat dazu geführt, dass sein Schreiben selbst in die Nähe des großen Vorbilds gerückt ist.