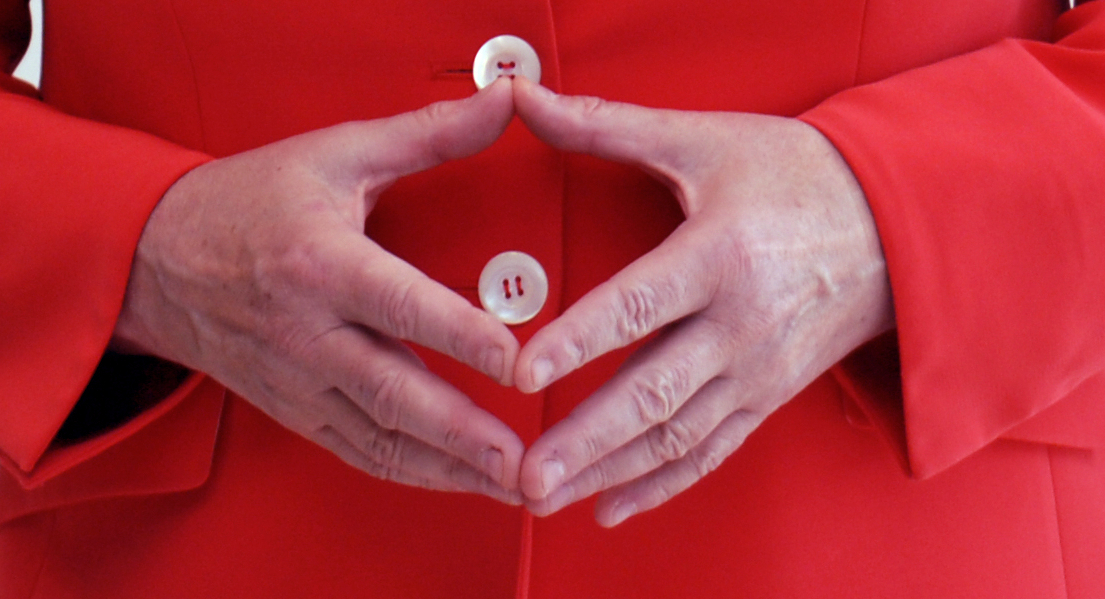Die Amtszeit von Martin Schulz an der Spitze des Europäischen Parlaments geht unwiderruflich zu Ende. Der deutsche Sozialdemokrat hat der europäischen Sache gutgetan, aufrecht, überzeugend, verbindlich. Nun wechselt er in die Bundespolitik und hinterlässt in Brüssel und Straßburg große Fußstapfen. In die wird ein konservativer Nachfolger treten. So ist es zwischen den großen Parlamentsfraktionen abgemacht, so hat es auch Martin Schulz unterschrieben, und so wird nun wieder einmal offenbar, dass eine großkoalitionäre Gepflogenheit jede Fortentwicklung des Europaparlaments überdauert hat.
Konservative und Sozialdemokraten machen beim Amt des Parlamentspräsidenten regelmäßig halbe halbe: die Sozialdemokraten bekommen die erste Hälfte der Legislaturperiode, die Konservativen die zweite. Eine satte Mehrheit ist dem jeweiligen Kandidaten ebenso sicher, wie die breite Rückendeckung während der Amtsführung. Lupenrein demokratisch ist das nicht, aber doch so praktisch und irgendwie bequem.
In seinen Anfängen verdiente das Parlament seinen Namen nicht, es war kaum mehr als demokratisches Schmuckwerk, und auch bei der ersten Direktwahl 1979, als es eine erste deutliche Aufwertung erfuhr, hielt es einem Vergleich mit nationalen Parlamenten bei weitem nicht stand.
„Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa“, lautete damals die unausgesprochene hämische Devise der deutschen Parteien. Das Projekt lag ihnen wohl am Herzen, doch als Sprungbrett für eine politische Karriere taugte das Europäische Parlament nicht. Wer, in Bonn ausgemustert, den Schritt nach Brüssel ging, kehrte nicht wieder zurück.
Das sieht, wie der Entschluss von Martin Schulz aktuell zeigt, inzwischen anders aus. In kleinen, aber beharrlichen Schritten, hat sich das europäische Parlament Kompetenzen erobert. Heute haben die 699 Abgeordneten in der EU ein wichtiges Wort mitzureden. Neben dem europäischen Rat und der Kommission ist das Parlament zum Dritten im Bunde der Macht aufgestiegen.
Der gewachsene Einfluss des Parlaments stärkt das Amt seines Präsidenten entsprechend.
Namen wie Egon Klepsch (CDU) und Klaus Hänsch (SPD) – beide respektable Amtsinhaber – sind lange in Vergessenheit geraten. Martin Schulz hingegen hat es zu einer Popularität gebracht, die ihn nicht nur als Außenminister in der Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier geeignet erscheinen lässt, sondern auch als Kanzlerkandidaten der SPD ins Gespräch bringt.
„Martin kann Kanzler“, zwitschert schon eine Fangemeinde, die den Mann aus Würselen für den besseren Herausforderer von Angela Merkel hält, als den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Der will im Januar entscheiden, ob er selbst ins Rennen geht, oder aber – aussichtslos, wie das Unterfangen ihm wohl scheint – erneut einem anderen den Vortritt lässt.
Schulz genießt Ansehen und Sympathie über die Parteigrenzen der SPD hinaus. Kandidat kann der 60-Jährige aber nur von Gabriels Gnaden werden. Das mag dem glühenden Europäer nun wie eine ironische Laune des Schicksals vorkommen. Denn lange, aber vergebens, hatte er wohl auf die Gunst von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehofft, sein Brüsseler Präsidentenamt über die vereinbarte Zeit hinaus bis 2019 bekleiden zu dürfen.
Sein gewichtigstes Argument: wenn er, wie vereinbart, im Januar seinen Posten für einen konservativen Nachfolger räumt, sind die drei Machtzentren der EU komplett in „schwarzer Hand“. Schulz drang, weil es in der konservativen EVP-Fraktion zu einem Beinahe-Aufstand kam, mit seinem Ansinnen letztlich nicht durch, und da ihn die Hinterbänke des Europaparlaments nun so gar nicht reizen können, schlägt er erstmals die umgekehrte Richtung ein: von Europa nach Berlin. Gut möglich, dass ihm die tatsächliche Strecke bald in beiden Richtungen vertraut sein wird. Für einen deutschen Außenminister, der sich der europäischen Einigung verpflichtet fühlt, steht sie regelmäßig im Terminplan.
Bildquelle: Wikipedia, Mettmann, CC BY 3.0