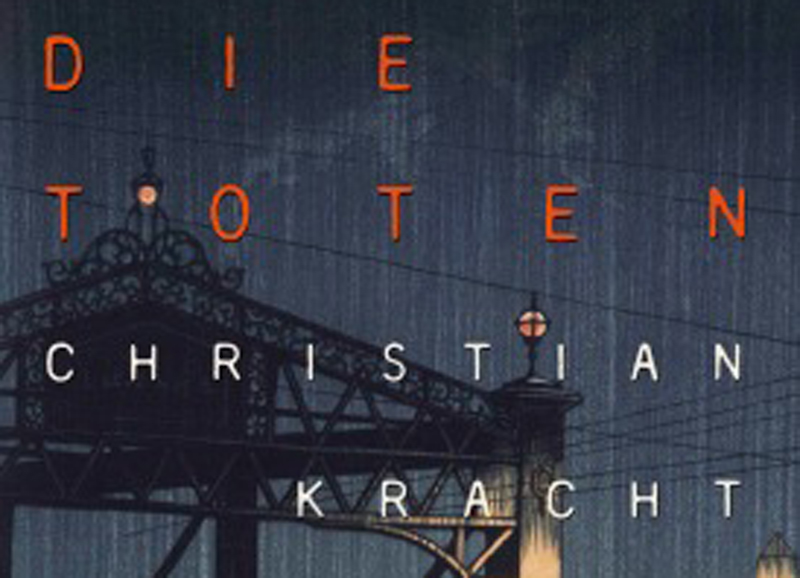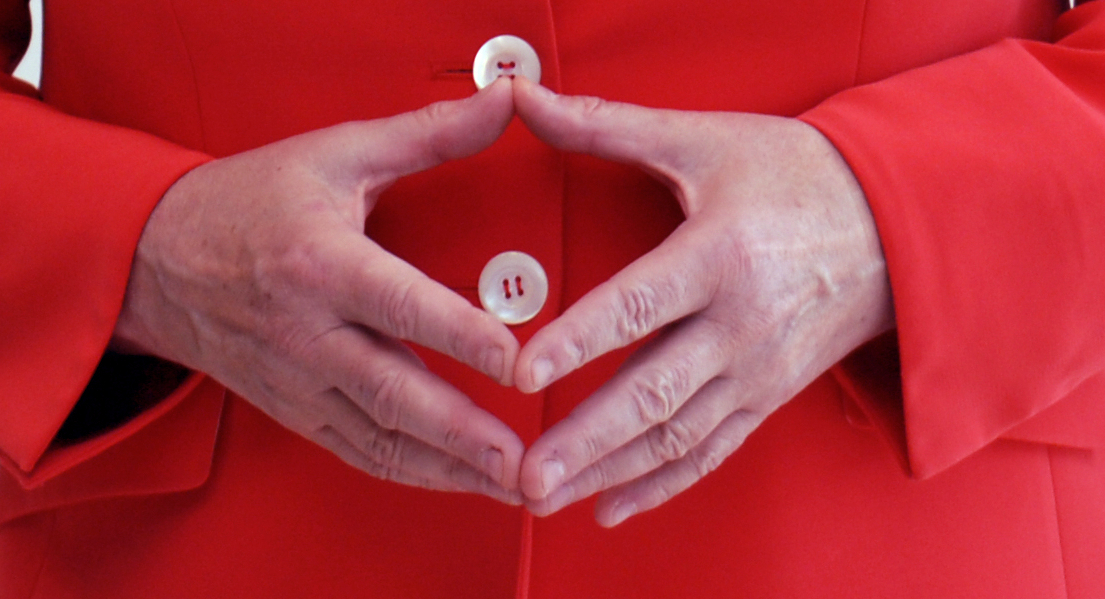Ein gewisser Hang zum Exotismus hat seit jeher den europäischen Blick auf Japan bestimmt. Dies war bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so, als nach jahrhundertelanger Abschottung Japan sich erzwungenermaßen der Welt öffnete und infolgedessen erstmals in relevantem Umfang japanisches Kunsthandwerk in die Welt gelangte. Europäische Künstler konnten sich für die Fremdartigkeit und elegante Andersartigkeit der ukiyo-e genannten japanischen Bilder dieser Zeit begeistern. Dieser vor allem in Frankreich ausgeprägte japonisme, also der Einfluss japanischer Kunst, lässt sich etwa bei Monet, van Gogh oder auch Klimt feststellen. Doch auch heute noch ist unsere Wahrnehmung Japans eine auf das, zwar positiv besetzte, aber doch schlechthin Andere fixierte. So schwanken Reiseberichte in Zeitung oder Fernsehen zwischen dem japanischen Zen-Garten, dessen spezielle Ästhetik darauf basiert, dass alles natürlich und zufällig wirkt, hinter dem sich jedoch ein (für den Europäer scheinbar unmöglich zu verstehendes) Gesetz versteckt, den schrill-bunten Spielhallen Tokios, und den berühmt-berüchtigten Maid-Cafés, in denen hübsche junge Frauen in knapp geschnittenen Dienstmädchenkostümen um ihre zumeist männlichen Gäste herumscharwenzeln.
Dass ein Großteil des neuen Romans von Christian Kracht, dessen literarisches Schaffen schon zuvor oft exotischen Räumen galt, nun in Japan spielt, verwundert also nicht. Die Frage nach den Bildern und der Wahrnehmung stellt sich umso mehr, da es sich bei Die Toten um einen Roman handelt, der vom Film erzählt. Im Mittelpunkt stehen dabei der schweizerische Regisseur Emil Nägeli und der japanische Kulturfunktionär Masahiko Amakasu, deren Geschichte, sich in vielerlei Hinsicht spiegelnd, parallel erzählt wird. Amakasu möchte zu Beginn der Dreißiger Jahre mit dem gerade nationalsozialistisch gewordenen Deutschland eine „zelluloidene Achse“ schmieden und schreibt zu diesem Zweck an den damaligen Chef der UFA Alfred Hugenberg und bittet, man möge ihm doch einen deutschen Regisseur und deutsche Filmausrüstung schicken, um gemeinsam den Kulturimperialismus des gerade aufsteigenden Hollywoodfilms zu bekämpfen. Um sein Anliegen zu unterstreichen und die Deutschen zu beeindrucken, sendet er Hugenberg eine Filmrolle, auf der zu sehen ist, wie sich ein junger Offizier beim rituellen Selbstmord den Bauch aufschneidet um daran zu verbluten. Der Leser wird dabei sozusagen zum Peeping Tom zweiter Ordnung, er folgt dem Blick der Kamera, die im Nebenzimmer aufgestellt wurde und durch ein Loch in der Wand das Geschehen aufzeichnet. Das Spiel mit der Wahrnehmung fängt bereits in dieser ersten Szene (man kann es in diesem Fall wohl durchaus so nennen) des Romans an. Die einzige Szene dieses snuff-movies wird auf eine an Quentin Tarantino erinnernde Weise ästhetisiert: „und eine Blutfontäne spritzte seitwärts zur unendlich zart getuschten kakejiku, zur Bildrolle hin. Es sah aus, als sei das kirschrote Blut mittels eines Pinsels, den ein Künstler mit einer einzigen, peitschenhaften Bewegung aus dem Handgelenk ausgeschüttelt hatte, absichtlich quer über die kakejiku geklatscht worden, die dort in erlesener Einfachheit im Alkoven hing.“ Der Fokus des Erzählers liegt, wie bei Kracht üblich, auf der Oberfläche, beschreibt das ästhetische Phänomen.
Der zum Klischee gewordene ritualisierte Selbstmord bildet jedoch nur den Auftakt von spielerisch verwendeten, an exotischen Klischees reichen Schilderungen, die, und das ist bemerkenswert, in den meisten Fällen mit Emil Nägeli verbunden sind. So bleiben weder Reisterrassen noch die Kirschblüte aus und Nägeli glaubt in einer Holzhütte im japanischen Wald etwas Tieferes zu erblicken, wenn diese „ihn in den Zustand eines unaussprechlich tiefen Empfindens vollkommener Harmonie versetzte“. Später in Tokio angekommen empfindet er es beim Blick auf die überirdischen Telefonmasten sogar als „köstlich, wie jenes Bündel Telefondrähte dort in der Mitte durchhängt“. Wer Kracht kennt, der weiß, dass alles unter dem Verdacht der Ironie steht und der Erzähler, der recht ähnlich wie schon in Krachts letztem Roman Imperium mit einem etwas altertümlichen, teilweise in Beobachtungen mäandernden Ton eines nochmals ins Ironische gewendeten Thomas-Mann-Erzählers daherkommt, verschärft diese Unsicherheit umso mehr.
Zu dieser Unsicherheit gehören auch die kleinen Verschiebungen der erzählten Welt, die teilweise augenfällig sind, etwa wenn dem mehrmals an prominenter Stelle im Roman auftretenden Charly Chaplin zu dessen Ende hin ein Mord angedichtet wird, in vielen Fällen jedoch glatt überlesen werden können. Diese Verschiebungen fügen sich ein in die Camp-Ästhetik (das ist, grob gesagt, der Drahtseilakt auf der Grenze zum Kitsch), zu der auch der teilweise zu einer Art literarischen Zuckerbäckerstil neigende Erzählton gehört.
Sowohl Nägeli als auch Amakasu arbeiten sich an ihrer kulturellen Herkunft ab und drohen im freien Spiel der Zeichen verloren zu gehen. Jedoch ist das Problem mit den Zeichen nicht mehr das der Moderne von Auseinanderfallen von Signifikant und Signifikat, es besteht vielmehr die Gefahr, dass die Zeichen eigentlich für überhaupt nichts mehr stehen und dahinter nur Leere liegt. Genau darauf läuft auch der von Exotismen geprägte Blick auf Japan hinaus. Quasi im Umkehrschluss zeigt sich, dass es nichts Tieferes zu erblicken gibt, dass die mit dem Blick auf Japan verbundene Sehnsucht, dass hinter diesen fremden Zeichen auch für den Europäer eine Wahrheit stecken müsse, ein Irrglaube ist. So empfindet Nägeli zu Gast in Amakasus europäisch anmutender Villa deren Einrichtung mit mittelalterlich wirkenden europäischen Möbeln, die „wie auf einem Filmset“ wirken, nur befremdlich. Der Blick Amakasus, der sieben Sprachen spricht und sich für Bach begeistert, auf Europa, folgt dem gleichen Exotismus wie Nägelis Blick auf Europa. Doch hinter den Zeichen in Form der Einrichtung entdeckt Nägeli in einem Schrank den Eingang in eine Zwischenwand, das Haus hat „ein westliches Ambiente nur vorgetäuscht“ und er fühlt sich „auf einmal hinter, oder vielmehr in den Kulissen eines Theaters.“ So verhält sich auch der Roman, der formal nach den Regeln des japanischen No-Theaters komponiert ist. Unter der Oberfläche der Zeichen lauert ein dunkles Meer des Nichts, in dem Amakasu am Ende des Romans buchstäblich versinkt.
Also ist am Ende eigentlich alles vergeblich, und was in eleganten Sätzen konstruiert wird nur eine Art postmoderner Meta-Hoax? Vielleicht. Doch auch wenn uns vor Augen geführt wird, wie und in welchen Bahnen unsere Wahrnehmung, vornehmlich des Fremden, verläuft, bleibt doch das Vergnügen an den fabulierenden Beschreibungen von enormer sprachlicher Schöhnheit. Diese bleibt ebenso wie die Empfindung der Schöhnheit durch Nägeli, auch wenn sie einem Fehlurteil aufsitzt, bestehen.
Dieser Roman ist letztlich ein wunderschönes Spiel mit Intermedialität, das sowohl Film- als auch Literaturliebhaber glänzend unterhalten und zur Reflexion über die den jeweiligen Medien eigenen Verfahren einladen wird. Dabei zeichnet Die Toten sich auch durch einen unbedingten Formwillen aus, der derart ausgeprägt selten zu finden ist, und durch den es viel wichtiger wird, wie etwas erzählt wird, als was eigentlich erzählt wird. Doch damit wären wir wieder beim Anfang.
Bildquelle: http://www.kiwi-verlag.de/, Kipenheuer & Witsch