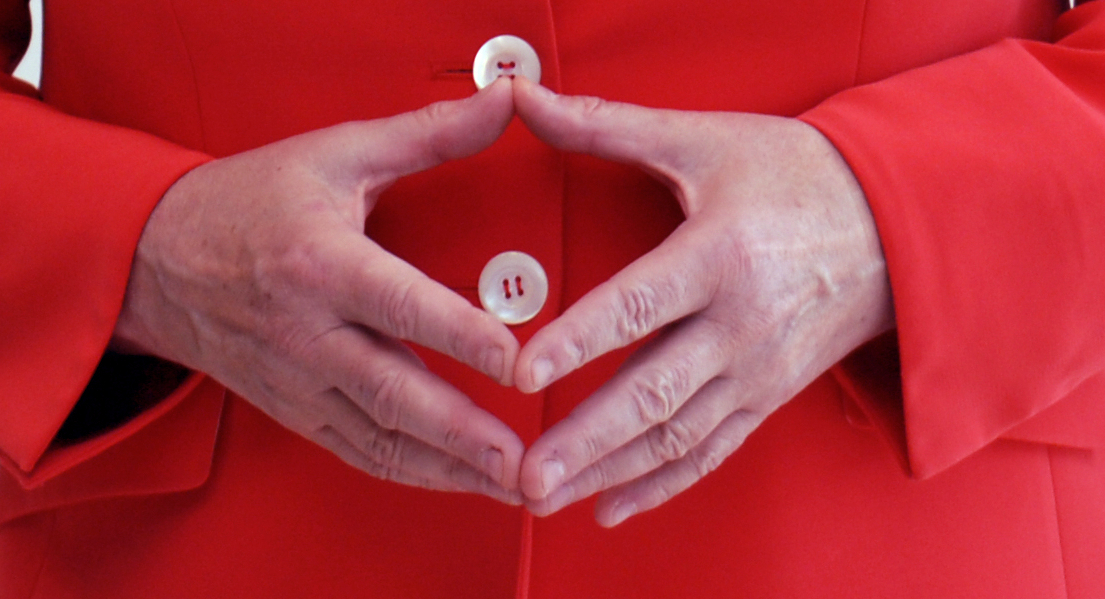Joseph Alois Schumpeter war nicht nur Ökonom. Auch zur Demokratietheorie hat er wichtige Thesen beigesteuert, so seine pessimistische Analyse der Fähigkeit der Bürger, politische Fragen rational zu behandeln. „So fällt der typische Bürger auf eine tiefere Stufe der gedanklichen Leistung, sobald er das politische Gebiet betritt“, schreibt er in seinem 1942 erschienenen Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“. Seine „realistische Demokratietheorie“ setzt daher weniger auf Bürger als auf Eliten, die ihre „Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfs um die Stimmen des Volkes erwerben.“
Im politischen Wettbewerb um die Präsidentschaft in den USA, bislang ausgetragen in Vorwahlen und Parteiversammlungen, ist der Immobilienmilliardär Donald Trump inzwischen ein gutes Stück vorangekommen, seit die letzten Rivalen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei ausgeschieden sind. Er gilt nun als der voraussichtliche Kandidat „seiner“ Partei – seiner in Anführungszeichen, denn er hat die Partei quasi im Handstreich übernommen, gegen das Parteiestablishment, seinen Geldadel und vor allem seine konservativen Vordenker. Mit Unterstützung überforderter Bürger, deren „reduzierter Wirklichkeitssinn“, um noch einmal Schumpeter aufzugreifen, auch ein „reduziertes Verantwortungsgefühl“ zur Folge hat?
Das bislang Undenkbare denken: Donald Trump könnte Präsident der USA werden
Seit Trump die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner nicht mehr zu nehmen ist, ohne demokratische Spielregeln zu verletzen, herrscht Ratlosigkeit, Entsetzen – ja auch Panik. Nicht nur bei „seiner“ Partei oder dem, was von ihr noch übrig ist, sondern auch in den Medien, dem Kommentariat auf beiden Seiten des politischen Spektrums oder den Experten, deren Zahlen und Berechnungen einen Erfolg Trumps nicht hergaben. Nun leistet man Abbitte, leckt die Wunden, versucht den eigenen Fehleinschätzungen auf den Grund zu gehen. Und man zwingt sich, das bis vor kurzem noch Undenkbare zu denken: Ein Präsident namens Donald Trump wird im Januar nächsten Jahres als Nachfolger von Barack Obama vereidigt. Ein Gedanke, der auch Europäer schaudern lässt, nicht nur, weil sich niemand so recht vorstellen kann, wie Trump seine Hand auf die Bibel legt und einen Eid auf die Verfassung ablegt.
Undenkbar war das bis vor kurzem deshalb, weil Donald Trump alles vermissen lässt, was einen ernsthaften Präsidentschaftskandidaten ausmacht. Stattdessen machte er durch Hasstiraden auf sich aufmerksam – auf undokumentierte Einwanderer, Muslime und andere Minderheiten. Ermunterte seine Anhänger zur Gewalt gegen angebliche Störer bei seinen Veranstaltungen oder drohte gar mit Auseinandersetzungen, sollte ihm die Kandidatur beim Parteikonvent im Juli streitig gemacht werden. Redete konfuses Zeug in Interviews mit Journalisten, die ihm vergeblich Positionen zu wichtigen Themen entlocken wollten. (Zitat Washington Post: „Donald Trump’s interview with the Washington Post is totally bananas.”) Räumte Positionen und widersprach sich, so dass die lange Liste seiner Ankündigungen, was er im Amt zu tun gedenke, praktisch wertlos ist.
Das alles schreit förmlich nach einer Erklärung, zumindest wenn einem am Erhalt der Demokratie in den USA gelegen ist. Vieles wird angeboten von Medienschelte bis hin zu historischen Rückblicken, die in Trump eine Reinkarnation des 1828 gewählten Präsidenten Andrew Jackson sehen. Bei ihm war die „Politik des Vulgären“, so der Historiker Paul Nolte, gepaart mit Rücksichtslosigkeit gegenüber Minderheiten wie den Cherokee-Indianern, die er aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet im Südosten der USA vertreiben ließ. Weitere zwielichtige historische Gestalten bieten sich an, in deren Fußstapfen der Präsidentschaftskandidat der Republikaner treten könnte, von den Populisten des ausgehenden 19. Jahrhunderts bis hin zum modernen Rassisten George Wallace, der als Gouverneur von Alabama alles daransetzte, die Rassentrennung beizubehalten. Das politische System der USA hat schon so manchen Stresstest überstanden. Panik ist nicht angebracht, das darf man aus diesem historischen Rückblick schließen.
Richtig ist aber auch: Mit Politikern, die sich im Wettstreit um die politische Macht an bestimmte Spielregeln halten – eine Voraussetzung der Schumpeter‘schen Eliten-Demokratie – hat der Aufstieg Donald Trumps wenig zu tun. Viele Faktoren haben zu seinem Erfolg beigetragen, darunter Fehleinschätzungen, mangelnder Widerstand der Anständigen, Sensationslust der Medien. Das erklärt jedoch nicht den Zuspruch, den Trump in Teilen der Wählerschaft erhalten hat. Ob der ausbaufähig ist, steht noch dahin, die Präsidentschaft ist für Trump noch nicht zum Greifen nahe. Aber er wird nach ihr greifen, das steht nun fest.
Politik und Regierung in Washington sind dysfunktional
Meine These lautet: Statt in die historische Ferne zu schauen, sollte man versuchen nachzuvollziehen, wie die Bürgerinnen und Bürger der USA ihre Regierung in Washington wahrnehmen. Die kommen nämlich beim Blick auf das Weiße Haus und das Kapitol an einer Feststellung nicht vorbei: Politik und Regierung in Washington sind dysfunktional.
In Washington wird nicht regiert, sondern blockiert. Ein mit satter Mehrheit wiedergewählter Präsident steht ihm feindlich gesonnenen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus gegenüber. Im erbitterten Gegeneinander riskiert man die finanzielle Stabilität des Landes, macht die Regierung für ein paar Wochen dicht. Die Politiker kriegen keinen vernünftigen Haushalt auf die Reihe, stattdessen verordnet man mehr oder weniger willkürliche Kürzungen. Dann zieht sich der Präsident auch noch aus der Weltpolitik zurück, obwohl er doch Oberbefehlshaber der größten Militärmacht der Welt ist, und überlässt autoritären Herrschern anderer Länder das Feld. Jüngster Beleg für die Dysfunktionalität der Politik in Washington: Der republikanisch beherrschte Senat weigert sich, einen vom Präsidenten für den Obersten Gerichtshof vorgeschlagenen Kandidaten überhaupt anzuhören und riskiert damit auch eine Blockade und einen Verlust an Ansehen dieser Institution.
Wenn man das nicht gelassen mit anschauen kann, sondern von – berechtigten oder unberechtigten – Ängsten um die eigene Existenz geplagt wird: Kann es da naheliegen, jemanden als Präsidentschaftskandidat zu unterstützen, der verspricht, den Laden in Washington richtig aufzumischen? Der autoritär und ohne Rücksicht auf die Feinheiten der Verfassung durchgreift, um das Land vor dem Schlimmsten zu retten – den Auswirkungen der Globalisierung, dem Freihandel, den Unternehmen, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern und im Lande selbst keine Steuern bezahlen. Der den vermeintlichen Demütigungen, denen das Land seit den verkorksten Kriegen George W. Bushs ausgesetzt ist, ein Ende bereitet? Der nicht als Weltverbesserer daherkommt, sondern denen mit Vergeltung droht, die Amerika Schaden zufügen wollen? Der das drohende Versagen des Staates abwendet, dessen ohnehin sparsamem Versprechen einer Rente im Alter kein Glaube mehr zu schenken ist? Was hilft es, wenn man glaubt, wie das bei 71 Prozent der Trump-Anhänger der Fall ist, dass man es durch harte Arbeit zu etwas bringen kann, wenn die Regierung in Washington dafür nicht die Rahmenbedingungen schafft? Wobei es den aufgebrachten Wählern weniger darauf ankommt, ob der Kandidat seine Versprechungen einhalten wird – enttäuscht ist man ja ohnehin, schlimmer kann es eigentlich nicht werden?
Sind die gut 10 Millionen US-Bürger (in der Mehrzahl Männer, wie wir wissen), die bislang für Trump gestimmt haben, wirklich von allen guten Geistern verlassen? Sind sie eine aktuelle Bestätigung für die These des Ökonomen Schumpeter, dass es einfachen Bürgern eben nun einmal an Wirklichkeitssinn und Verantwortungsgefühl fehlt, wenn es um Politik geht?
Das Vertrauen in die Regierung ist hin
Trump ist zweifellos nicht die richtige Antwort auf das Versagen von Politikern in Washington. Aber als Antwort der Politikverdrossenen darf man seinen Erfolg schon interpretieren.
Dieses Versagen ist vielfältig dokumentiert und vermessen worden. So von den Politikwissenschaftlern Marc J. Hetherington und Thomas J. Rudolph in ihrem 2015 erschienen Buch „Why Washington won’t work“. Darin gehen sie der Frage nach, warum den Amerikanern das Vertrauen in Politik und Regierung in Washington abhanden gekommen ist. Zu Beginn der 1960er Jahre, als der Präsident in Washington Lyndon Johnson hieß, vertrauten noch 70 Prozent der Demokraten und mehr als 60 Prozent der Republikaner der Regierung in Washington. Doch danach ging es stetig bergab, abgesehen von kurzen Erholungen wie nach den Anschlägen des 11. September 2001. Zahlen, die man auch in einem Bericht des partei-unabhängigen Pew Research Centers nachlesen kann.
Dabei vertrauen die Republikaner eigentlich nur noch einer Administration, die von einem der ihren gestellt wird, während die Demokraten etwas großzügiger mit republikanischen Amtsinhabern sind. Doch im Jahr 2015 waren es gerade noch 19 Prozent der Befragten, die der Regierung in Washington immer oder meistens zu vertrauen bereit waren. Ganz schlecht sieht es aus, wenn man die Zahlen für den Kongress anschaut: 69 Prozent der Befragten haben keine gute Meinung von ihrem Parlament, nur 27 Prozent sehen den Kongress positiv. Was noch erstaunlicher ist: Gerade mal 23 Prozent der Republikaner sehen den Kongress positiv, obwohl die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit stellen. Die Zahl ist geringer als bei den Demokraten, von denen immerhin 31 Prozent eine positive Meinung vom Kongress haben.
Kein Zweifel: Die Wählerinnen und Wähler der USA sind frustriert über ihre Regierung. Dabei haben sie eine recht genaue Vorstellung davon, was sie von ihrer Regierung erwarten und schätzen einzelne Regierungsinstitutionen positiver ein als den gesamten, von Politikern gelenkten Regierungsapparat. „Warum lassen die Leute sich das bieten?“, fragen die beiden Forscher Hetherington und Rudolph. Warum ist die Öffentlichkeit so träge und lässt sich von ihren Politikern so schlecht in Washington vertreten?
Die Bürgerinnen und Bürger melden sich zu Wort – kein Weiter So
Worauf die beiden Forscher nicht gekommen sind: Die Bürgerinnen und Bürger überwinden ihre Trägheit und machen ihrem Ärger Luft, indem sie Populisten unterstützen – auf der Linken einen langjährigen Kämpfer, Bernie Sanders, der eigentlich zum Washingtoner Polit-Establishment gehört, sich selbst aber als „demokratischen Sozialisten“ bezeichnet. Auf der Rechten den Milliardär Donald Trump, der auf dem politischen Spektrum kaum zu verorten ist, aber großspurig und gehässig daherkommt und Amerika wieder zu alter Größe verhelfen will.
Wenn man die Dysfunktionalität der amerikanischen Politik anschaut und Wahlen als Mittel begreift, mit dem die Bürgerinnen und Bürger eines Landes alle zwei oder vier Jahre ihren Senf dazu tun können, was die politische Elite intern so treibt, so könnte man zu dem Schluss kommen, dass zumindest einige US-Bürger ihre Trägheit überwunden haben und nicht wollen, dass so wie bisher in Washington weitergewirtschaftet wird. Zwar handeln sie bei ihrer Stimmabgabe für Trump verantwortungslos, was die möglichen Folgen anbetrifft, aber nicht ohne einen gewissen Sinn für die politische Wirklichkeit in ihrem Lande.
Das Schlimmste – ein Präsident Donald Trump – lässt sich vielleicht noch abwenden. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn die voraussichtliche Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, könnte wie schon Barack Obama auf die Stimmen der Minderheiten, Latinos, Asiaten und vor allem Afroamerikaner bauen. Gelingt es ihr dann noch die jugendlichen Anhänger von Bernie Sanders in Teilen zu gewinnen, sieht es für sie am 8. November gar nicht so schlecht aus.
Clinton muss überzeugend gewinnen, um den Spuk des Trumpismus zu bannen
Doch ein knapper Wahlsieg der Demokratin Hillary Clinton von etwas mehr als 50 Prozent der Stimmen und einer etwas größeren Mehrheit im Electoral College reichen nicht aus, um den Spuk des Trumpismus zu bannen. Um als strahlende Siegerin dazustehen, die auf ein Mandat der Wähler verweisen kann, wird Hillary Clinton auch für die Wiedererlangung der Mehrheit der Demokraten im Senat kämpfen müssen. Dabei wird sie auf die Sprecherin des progressiven Flügels der Partei Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts, bauen können, die sich als Verbraucheranwältin und Kritikerin der Wall-Street einen Namen gemacht hat und die Sanders-Anhänger ins Boot holen könnte. Wenn die Republikaner dann noch Mandate im Repräsentantenhaus verlieren, wo sie über strukturelle Vorteile verfügen, könnte die neue Präsidentin mit Rückenwind regieren.
Donald Trump würden hingegen 50,1 Prozent der Stimmen oder eine Mehrheit im Electoral College schon ausreichen, um sich Respekt in Washington zu verschaffen. Als Wahlsieger hätte er sich gegen das Establishment in seiner Partei, die Medien und viele Prognosen durchgesetzt. Daher würde seine Wahl zweifellos als gravierende Veränderung der politischen Landschaft in den USA interpretiert, eine Art Umsturz oder Revolution. So wie einst die Wahl von Ronald Reagan. Der erreichte bei seiner ersten Wahl 1980 zwar nur 50,7 Prozent der abgegebenen Stimmen, aber im Rückblick wurde daraus ein großer Wahlsieg, der die oppositionellen Demokraten im Lande einknicken und auf einen Verhandlungskurs mit dem konservativen Präsidenten einschwenken ließ.
Nur ein überzeugender Wahlsieg verleiht dem Gewinner der Präsidentschaftswahl in den Augen der Öffentlichkeit ein Mandat und erlaubt es ihm, seine Agenda umzusetzen. Wenn es Hillary Clinton trotz ihrer zahlreichen Handicaps gelingt, Donald Trump überzeugend in die Schranken zu verweisen, hätte sie den Spuk gebannt und könnte darangehen, das Land zu regieren und eventuell auch zu versöhnen. Und auch die Republikaner könnten einen Neuanfang wagen – diesmal richtig und anders als nach der verlorenen Wahl 2008.
Bildquelle: von Max Goldberg from USA (Trump CAUCUS) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons