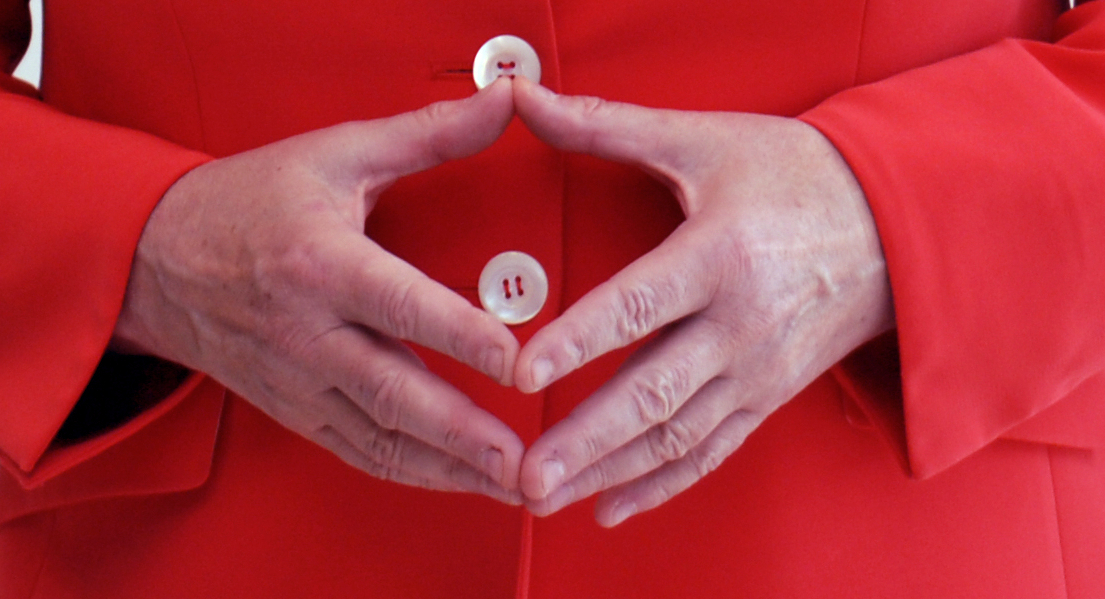In den frühen Morgenstunden des 26. April 1986 kam es zum „Super-GAU“. Im sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl explodierte ein Reaktor, und kein Superlativ genügte, um die Katastrophe zu benennen. Radioaktive Wolken verbreiteten die Gefahr über tausende Kilometer nach ganz Europa. Wochen des Bangens vor den giftigen Niederschlägen folgten.
Auch in Deutschland herrschte tiefe Verunsicherung. Aufenthalte im Freien, besonders Sport- und Kinderspielplätze wurden gemieden, Gemüse, Obst und Salate vernichtet, die Versorgung von Säuglingen war angstbesetzt, das öffentliche Leben beeinträchtigt, auch durch das Misstrauen gegenüber der offiziellen Informationspolitik. „Bis heute“, so der Vorwurf der Ärzteorganisation IPPNW, versuche die Atomwirtschaft „die Katastrophe von Tschernobyl kleinzureden“.
30 Jahre danach ist der Super-GAU unbewältigt. Seine Folgen sind in ihrem ganzen Ausmaß nicht (an-)erkannt, die Konsequenzen nicht gezogen. Erst ein Vierteljahrhundert nach Tschernobyl setzt das Reaktorunglück im japanischen Fukushima ernsthafte Zweifel an der Beherrschbarkeit der Atomenergie auch in den Regierungsetagen frei; Deutschland beschließt den Atomausstieg. Doch die radioaktiven Risiken sind damit nicht aus der Welt.
Unmittelbar am havarierten Kraftwerk arbeiteten in den Wochen und Monaten nach dem Super-GAU mehr als 800.000 Aufräumarbeiter, Männer und Frauen, so genannte Liquidatoren. „Sie erhielten die größte Strahlendosis und erlitten die schwerwiegendsten gesundheitlichen Schäden“, berichtet die Ärzteorganisation IPPNW. Inzwischen seien schätzungsweise 120.000 von ihnen gestorben, „die Haupttodesursache waren Hirn- und Herzinfarkte“.
Einige dieser Liquidatoren sprechen in diesen Tagen vor Schulklassen über ihre Einsätze am Unglücksreaktor. Auf Einladung des Internationalen Bildungs- und Begegnungswerks (IBB) Dortmund schildern die Zeitzeugen aus der heutigen Ukraine und Belarus die Umstände, unter denen sie damals arbeiteten mussten, und die Geringschätzung, die sie im Nachhinein erfuhren. Ihr Schicksal blieb über all die Jahre ungewürdigt, mit den gesundheitlichen Folgen blieben sie alleingelassen, nicht in der Lage, teure Therapien und Medikamente zu finanzieren.
Das IBB Dortmund, hervorgegangen aus zahlreichen Tschernobyl-Initiativen, die sich nach dem Reaktorunglück gründeten und Millionen von Kindern Erholungsaufenthalte in Deutschland ermöglichten, gibt den „vergessenen Helden“ Gesichter und Stimme zurück. Als Soldaten, Feuerwehrmänner und Piloten kämpften sie – teilweise nur mit einem Mundschutz ausgestattet – bis der explodierte Reaktor wenigstens eine provisorische Schutzhülle erhalten hatte und keine weitere Radioaktivität austreten konnte. Im Rahmen der Europäischen Aktionswochen „Für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ hat Papst Franziskus ehemalige Liquidatoren aus der Ukraine und Belarus in seiner Generalaudienz empfangen. „Wir erneuern unsere Gebete für die Opfer dieses Unglücks und drücken den Helfern unsere Anerkennung aus und allen Initiativen, die versucht haben, die Leiden und die Schäden zu lindern“, sagte das Oberhaupt der Katholischen Kirche in Rom.
„Wir sind froh und dankbar, dass Papst Franziskus den Blick der Welt auf die Katastrophe von Tschernobyl und auf die vielen, bis heute Betroffenen gelenkt hat, denn diese Katastrophe ist auch 30 Jahre später noch lange nicht vorbei“, sagte Anatolij Gubarev, Vorsitzender des Liquidatorenverbandes Charkiw (Ukraine) in Rom. „Viele Generationen nach uns werden sich noch mit den Folgen dieser Tragödie beschäftigen müssen.“
„Die Würdigung durch den Papst ist ein wohltuendes Zeichen der Anerkennung für die Liquidatoren und für uns eine Ermutigung, weiterzumachen mit unserer Arbeit für ein Lernen aus der Geschichte“, sagte Peter Junge-Wentrup, Geschäftsführer des IBB Dortmund. „Wir brauchen die Energiewende in ganz Europa“, fügte Junge-Wentrup hinzu und schlug damit die Brücke zum Europäischen Parlament. Parlamentspräsident Martin Schulz begrüßte 52 ehemalige Tschernobyl-Liquidatoren und Vertreter der internationalen Tschernobyl-Solidaritätsbewegung aus Großbritannien, Spanien, den Niederlanden, Italien und Deutschland in Brüssel. Dort befasste sich eine Konferenz mit dem Titel „30 Jahre seit Tschernobyl – Zeitzeugen der Vergangenheit und Atomenergie heute“ mit den gesundheitlichen Auswirkungen der Katastrophe und mit der Zukunft der Atomenergie in Europa.
Bis zum Jahr 2030 sollen in Europa 160 Atomkraftwerke vom Netz gehen, zugleich erwägen Länder wie die Türkei und Litauen den Einstieg in die Nutzung der Atomenergie. Zusätzlich verdüstert die Ungewissheit über das nukleare Erbe die Perspektive. Zur Problematik der „Endlagerung“ kommt die Frage, wie nach Stilllegung und Abriss von Atomkraftwerken die Mengen an Stahl- und Betonabfällen entsorgt werden, die geringfügig kontaminiert sind. Laut Ärzteorganisation IPPNW sollen diese Materialien überwiegend in die normale Abfallverwertung eingespeist werden. „Die gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung sind dabei nicht absehbar – denn auch eine geringfügige zusätzliche Strahlenbelastung bedeutet ein gesundheitliches
Risiko.“
In Ost- und Westdeutschland befinden sich 25 Atomkraftwerke in verschiedenen Phasen der Stilllegung, erläutert IPPNW. In den nächsten Jahren kommen acht weitere Atommeiler hinzu. Darüber hinaus wurden oder werden in Deutschland mehr als 30 Forschungsreaktoren und über zehn Einrichtungen der nuklearen Ver- und Entsorgung stillgelegt. Die Gesamtkosten der Stilllegung seien für Deutschland offiziell auf 29,6 Milliarden Euro prognostiziert; allerdings beliefen sich allein für den Rückbau des AKW Obrigheim die Kosten bereits auf 1,5 Milliarden Euro.
Beim Abriss des Atomkraftwerks Neckarwestheim fallen, so IPPNW unter Berufung auf Betreiberangaben, etwa 3100 Tonnen endlagerpflichtigen Materials an, etwa der Reaktordruckbehälter und Teile des biologischen Schildes, aber auch Schleusen oder kontaminierte Rohrleitungen. Den weitaus größten Teil, mit 327.500 Tonnen gut das Hundertfache, machen die so genannten kalten Gebäudemassen, also unbelastete oder gering kontaminierte Materialien, aus. „Das Erschreckende“ sei, so die Ärzteorganisation: Der überwiegende Teil der gering kontaminierten Abfälle soll auf Hausmülldeponien gelagert, in Verbrennungsanlagen verfeuert oder überwiegend uneingeschränkt als normale Reststoffe verwertet werden. „So könnte verstrahltes Material unerkannt und ohne unser Wissen in unserem Alltagsleben auftauchen“, warnen die Ärzte. „Es könnte uns beispielsweise in Kochtöpfen, Heizkörpern, Zahnspangen, auf Kinderspielplätzen, im Straßenbelag oder auf Schotterwegen begegnen.“
Die gesundheitlichen Risiken dürfen einer IPPNW-Studie zufolge nicht verharmlost werden: Wenn wenige Menschen hohen Strahlendosen ausgesetzt sind, führt dies zu einer merkbaren Erhöhung von Krankheit und Sterblichkeit, da das Erkrankungsrisiko des Einzelnen stark ansteigt. Niedrige Strahlendosen erhöhen das individuelle Erkrankungsrisiko hingegen nur geringfügig. Wenn allerdings viele Menschen mit geringen Strahlendosen belastet werden, führt auch dies zu einer relevanten Erhöhung der absoluten Erkrankungszahlen.