Manchmal ist es gut, wenn ein Verlag ein rasches Geschäft wittert. Wie sonst wären wir in den Genuss zweier recht alter (1987 und 1997) Aufsätze des pingeligen US-amerikanischen Philosophen Harry G. Frankfurt über die „Ungleichheit“ gekommen.
Als Widerrede zu Pikettys aktueller Kapitalismuskritik, wie die Vorbemerkung suggeriert, können die zwar nicht geschrieben worden sein, aber Frankfurt hat sie aktualisiert. Deshalb beginnt der Text des kleinen Bändchens mit einem Obama-Zitat, das ausgewählt wurde, weil ihm widersprochen werden soll: nicht die Einkommensungleichheit sei das entscheidende Problem, sondern die in den USA weit verbreitet Armut. Der logische Beweis ist der Umkehrschluss: wenn alle Amerikaner gleich arm wären, wäre die Einkommensgleichheit hergestellt; besser wäre dadurch aber nichts. Im Gegenteil.
Frankfurt ist ein genauer, ein intelligenter, ein schlauer Wortakrobat. Es geht ihm um die höchstmögliche Genauigkeit der Begriffsbestimmung und diese Anstrengung ist für den Leser eine Bereicherung. Es macht Spaß, den Überlegungen zu folgen und es fällt leicht, weil sie sich auf das Thema der ökonomischen Ungleichheit beschränken und die scheinbar schwere Kost
häppchenweise verabreichen. Philosophie für Nicht-Philosophen – auf hohem Niveau. Es ist nicht Sache des Rezensenten, die Gedankenschritte Frankfurts hier nachzuzeichnen – das würde dem Leser des kleinen Suhrkampbändchens das Vergnügen der Lektüre rauben. Auf ein sehr schönes Argument gegen ein moralisches Gleichheitspostulat soll aber wegen des Schmunzelns
hingewiesen werden, dass es hervorruft, nämlich, dass es die Intellektuellen faul mache. Wieso?
Kein moralisches Problem
Ganz einfach, weil es viel einfacher ist, die Größe eines gleichen Anteils zu berechnen als „zu bestimmen, wie viel jemand von etwas haben muss, um genug davon zu haben. (..)Eine Theorie der Gleichheit ist dementsprechend viel leichter zu formulieren als eine Theorie der Suffizienz.“ Dem politisch Interessierten wird deutlich werden, wie ungenau die Begrifflichkeit von Gleichheit und Ungleichheit ist, wie wir sie alltäglich verwenden. Ebenso klar tritt hervor, dass Ungleichheit an sich kein moralisches Problem darstellt. Vor allem aber stellt Frankfurt klar, dass zahlreiche soziale und moralische Probleme, die sich aus Ungleichheit ableiten können, sehr gute Gründe für die Bekämpfung von finanzieller Ungleichheit liefern. Moralisch und tatsächlich müsse vorrangig dafür gesorgt werden, dass alle Menschen über „hinreichende Mittel verfügen“ – also nicht in Armut und Elend leben müssen.
Ein Lob der Ungleichheit liefert der Philosoph also keineswegs! Schon in seinem Vorwort macht er klar, dass als Folge von ökonomischer Ungleichheit „unannehmbare Ungleichheiten“ entstehen, „die mitunter fast so weit gehen, dass sie die Ernsthaftigkeit unseres demokratischen Selbstverständnisses untergraben“.
Soziale und humanitäre Missstände
In dem zweiten kleinen Aufsatz, der einen Fall behandelt, in dem „ökonomische Gleichheit in der Tat von einer gewissen moralischen Bedeutung sein kann“, nimmt Professor Frankfurt allen komplett den Wind aus den Segeln, die mit seiner Hilfe versuchen, soziale und humanitäre Missstände zu rechtfertigen, die sich aus Ungleichheit ergeben. Er schreibt: „ Die Annahme, dass der Egalitarismus…ein Ideal darstellt, dem irgendeine moralische Bedeutung innewohnt, weise ich kategorisch zurück. Das bedeutet entschieden nicht, dass ich die bestehenden Ungleichheiten grundsätzlich befürworte (…oder…) mich gegen Bemühungen zu ihrer Beseitigung oder Verringerung wende. Tatsächlich unterstütze ich viele solcher Bestrebungen..“
Man kann manch ein Argument in diesem Bändchen anzweifeln, die Schlüssigkeit und Überzeugungskraft der Argumentation nicht. Hierzulande ist dem Rezensenten noch keine öffentliche Diskussion von „Egalitarismus“ begegnet, gegen den sich das Büchlein wendet. Aber es gibt genug Beispiele für sprachliche Schludrigkeit, die auf falsche Fährten führt. Ein Beispiel ist das sehr empfehlenswerte Buch „Gleichheit ist Glück“ – es enthält an keiner Stelle diese steile These, sondern stellt mit dem dem englischen Original fest, „warum es Gesellschaften mit mehr Gleichheit fast immer besser geht.“ Von völliger Gleichheit ist nie die Rede – wie übrigens auch nicht bei den bedeutenden Vordenkern des politischen Sozialismus. Aus der sowjetkommunistischen Praxis wissen wir vielmehr, dass ein erzwungenes Gleichheitsideal die Freiheit tötet, um die es Sozialisten eigentlich gehen sollte.
Ökonomische Ungleichheit
Die Autoren Wilkinson und Pickett breiten in ihrem schon 2009 auf deutsch erschienenen Buch empirische Befunde aus, die darauf hinauslaufen, dass der Zusammenhalt von Gesellschaften umso bedrohter ist, als die ökonomische Ungleichheit zunimmt. Die Autoren benennen die Ungleichheit als Ursache für verschiedene, von ihnen untersuchte soziale Anomien und Epidemien. Eine zurückhaltendere Interpretation der Daten muss die Gleichzeitigkeit dieser Missstände mit großer ökonomischer Ungleichheit einräumen. Prof. Frankfurt verurteilt seinerseits ökonomische Ungleichheit als Ursache anderer, inakzeptabler Ungleichheiten.
Die Empiriker streben selbst in ihrem Ausblick nur nach „mehr Gleichheit“, als sie in den Gesellschaften vorgefunden haben, in
denen der Einkommensunterschied zwischen den reichsten 20% und den ärmsten 20% der Bevölkerung besonders groß war. Die geringsten Unterschiede von etwa dem 4fachen gab es Anfang dieses Jahrhunderts in den skandinavischen Ländern und in Japan, Spitzenreiter mit dem 7 bis fast 10fachen waren Singapur, USA, Portugal und England.
Zwischen diesen empirischen Befunden von Wilkinson und Pickett, ihrer Bewertung und den philosophischen Darlegungen Frankfurts bestehen weitaus größere Übereinstimmungen, als die so gegensätzlich erscheinenden Titel erwarten lassen. Beide schärfen Problembewusstsein angesichts der Entwicklungen in den reichsten Volkswirtschaften und die begriffliche Genauigkeit bei deren Behandlung.
Harry G. Frankfurt: Ungleichheit. Warum wir nicht alle gleich viel haben müssen. Suhrkamp
Frankfurt 2016.
Richard Wilkinson, Kate Pickett: Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für alle
besser sind. Tolkemitt bei 2001 Berlin 2009.
Bildquelle: Suhrkamp Verlag













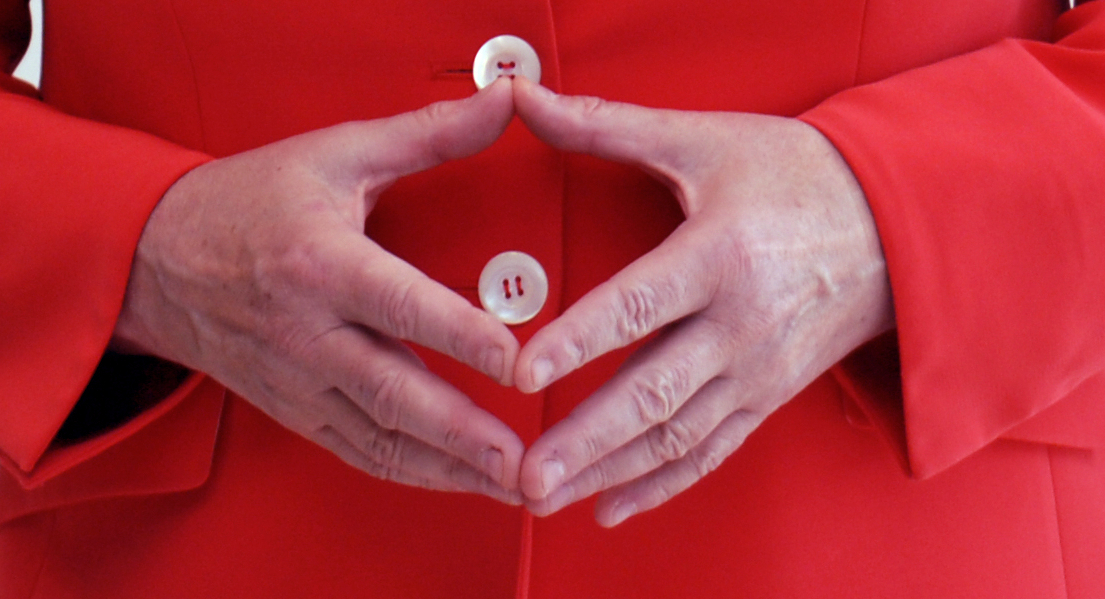


Ich kommentiere mich gewissermaßen selbst – aber nur, um darüber zu informieren, dass das besprochene Buch „Gleichheit ist Glück“ soeben in einer überarbeiteten Neuauflage und mit dem erfreulich nüchternen Titel „Gleichheit“ bei 2001 erschienen ist.