Das gibt es selten: Noch gar nicht da und schon totgesagt. So aber ist es der diesjährigen Documenta ergangen. Vor und während der 100 Tage ihres irdischen Daseins kam es zu einem nekrophilen Überbietungswettbewerb der Sterbeprognosen: Die laufende Documenta dürfe nicht beginnen oder müsse sofort abgebrochen werden, sie sei von ihrem indonesischen Kuratorenkollektiv Ruangrupa vor die Wand gefahren worden, der Stadt Kassel solle die „Weltkunstausstellung“ entzogen, die Ausstellung überhaupt und für immer eingestellt werden. Es wurde schrill. Aus Ermahnungen wurden Abmahnungen und schließlich, zwei Wochen vor dem regulären Ende der Documenta, erließ eine von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat der Documenta gGmbH eingesetzte „Expertenkommission“, die die Ausstellung auf antisemitische Inhalte durchkämmen sollte, das freilich nicht von allen ihren Mitgliedern getragene Dekret, eine Folge von drei palästinensischen Propagandafilmen aus den 60er Jahren dürfe nicht mehr gezeigt werden. Auch nach diesem „intellektuellen Feueralarm“ wurde erneut die sofortige Beendigung der Documenta gefordert. Bereits am folgenden Tag wies jedoch der Historiker Joseph Croitoru der „Expertenkommission“ minutiös nach, dass sie, wenn überhaupt, nur oberflächlich recherchiert hatte. Entgegen der Behauptung dieser Kommission gab es keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem japanischen Filmemacher und einstigen Mitglied der „Japanischen Roten Armee“ Adachi Masao und der Übergabe der nunmehr im Besitz des palästinensischen Kollektivs Subversive Film befindlichen und in Kassel gezeigten Filme („Tokyo Reels“). Soweit in diesen Filmen „krasse Propaganda“ vorkomme, werde diese durchaus benannt. Allerdings befürwortete auch Croitoru eine präzisere Kontextualisierung „durch zusätzliche, historisch vertiefende Informationen“ (Hessisch Niedersächsische Allgemeine [HNA], 15.09. 2022). Die mangelhafte Kommentierung betrifft jedoch nicht nur die inkriminierten Filme. Es handelt sich um ein übergreifendes Defizit nicht nur dieser Documenta, sondern auch ihrer Vorläufer.
Die hohen Wallungswerte, die die Wahrnehmung der Documenta fifteen erzeugt hat, könnten zu der Annahme verleiten, in ihr etwas schrecklich Einmaliges zu sehen. Das gilt allenfalls für die Intensität der Aufregungen. Bisher kannte noch jede Documenta ihre Skandale und Skandälchen. Interessanter ist, dass und wie die jetzigen Kontroversen und Probleme in die Vergangenheit der Ausstellung und auf Kontinuitäten in ihrer Entwicklung zurückweisen. Die Geschichte der Documenta lässt sich als Verkehrungen innerhalb ihrer Kontinuitätslinien beschreiben. Die Vorzeichen ändern sich, die strittigen Gegenstände bleiben. Etwas Tiefenschärfe im Blick auf die Ausstellungsgeschichte kann helfen, die diesjährige Documenta weit besser zu verstehen, als dies allein durch die Rezeption des Feuilleton-Alarmismus möglich wäre.
1.
Im wilden Jahr 1968 wurde auf der Documenta 4 die Institution der Ausstellung insgesamt in Frage gestellt, und zwar vor allem mit dem Vorwurf, die Gestaltung der Documenta richte sich nach dem Diktat des Kunstmarktes. Diese Kritik hat sich nunmehr verkehrt. Seit sich die Documenta ab 2002 den Themen Globalisierung und Migration öffnete, trifft sie zunehmend nachdrücklicher der Vorwurf, für den Kunstmarkt und seine Akteure uninteressant zu werden. Denn der neue ästhetische Fokus war zugleich mit einer Veränderung im Profil der ausstellenden Kunstproduzenten verbunden. An die Stelle ‚westlicher‘ Superstars traten unbekannte Künstler aus dem Süden und an die Stelle überwältigender Werke trat bereits 2002 eine „Vielzahl von Gruppenarbeiten“, wie die Documenta-Chronik der Stadt Kassel anmerkt. Die Kritik an der Kunstmarktferne wirkt bis zur jetzigen Documenta fort. Wie sollte es anders sein? Subjekte der Kunst und ihrer Ausstellung sind nun mehrheitlich Kollektive und die Documenta wird erstmals von einem Kollektiv kuratiert, der interdisziplinär zusammengesetzten Gruppe Ruangrupa (etwa „Kunstraum“ oder „Raumform“). Die Netzseite „Lumbung Member &Künstler*Innen“ enthält 72 Einträge, 46 Kollektive und 28 Einzelkünstler/innen bzw. Künstlerpaare.[i]
Die Klage über die Kunstmarktferne der Documenta verkennt die Verteilung der Ressourcen auf diesem Markt. Zwar beträgt der Marktanteil der Nachkriegs- und Gegenwartskunst, also der von ab 1910 geborenen Künstlern geschaffenen Werke, 55% der auf Kunstauktionen erzielten Einnahmen, aber allein 25% der ersteigerten Summen entfallen auf Werke von fünf Künstlern. Noch gravierender ist die Konzentration auf dem Teilmarkt der „modernen“ Kunst, die nach Marktkriterien von zwischen 1875 und 1919 geborenen Künstler/innen geschaffen wurde. Ihr Marktanteil bei Kunstauktionen beträgt 22%. Davon bestreiten fünf Künstler die Hälfte des Umsatzes. Den höchsten Erlös auf den Auktionen des Jahres 2021 erzielte mit 103,4 Millionen USD bei Christie’s in New York ein Werk aus dieser Gruppe, Picassos Sitzende Frau am Fenster (Marie-Thérèse) (1932). Bei einer Umfrage nach ihren wirtschaftlichen Prioritäten sahen die befragten Kunsthändler im Jahr 2021 in der Aufrechterhaltung des Kontaktes mit ihnen bekannten Sammlern die wichtigste Aufgabe des Geschäftsjahres (67%). Während 2019 und 2020 die Suche nach neuen Künstlern mit 18-20% immerhin auf Platz fünf der wichtigsten Geschäftsaufgaben rangierte, kam sie 2021 nicht mehr unter die ersten fünf, soll aber 2022 wieder den alten Platz auf der Rangliste der Prioritäten einnehmen. Damit spiegelt dieser Rang in etwa die Präferenzen der Käufer wider, die sich nach dem Bericht Art 2022[ii], dem die hier präsentierten Daten entnommen sind, im Wesentlichen aus dem reichsten einen Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung zusammensetzen: von den 56 Millionen „HighNetWorth Individuals“, die jährlich über 1-5 Millionen USD als flüssige Geldmittel verfügen und die die „Fußtruppen“ des Kunstmarktes stellen, bis hin zu den ca. 2657 Milliardären weltweit. Die Daten zeigen, dass der globale Kunstmarkt nicht nur elitär, sondern in gewisser Weise auch innovationsskeptisch bis konservativ ist. Eine Documenta, die den Trends des Kunstmarktes hinterherliefe, würde an ihrer Selbstabschaffung arbeiten.
2.
Eng mit diesem Prozess verbunden ist ein Wandel der Politik der Documenta. Obwohl die Gründungsakteure als typisch deutsche Mandarine die Politik der Documenta in das konservative „Syndrom des Unpolitischen“ eingesponnen hatten – 10 von 30 Männern des inneren Zirkels waren vormals Mitglieder der NSDAP gewesen, dann gewiefte Vertuscher geworden, war bereits die Standortwahl Kassel ein Politikum. Durch die deutsche Teilung und die dadurch unterbrochenen Verkehrsverbindungen aus der Mitte des Reiches an die östliche Peripherie des Weststaates verrückt, in milderen Gefilden jetzt süffisant „Hessisch-Sibirien“ genannt, sollte die einstige Hauptstadt eines Kleinfürstentums, Standort für Lokomotiv- und Waggonbau und spätere Waffenschmiede zumindest alle vier bzw. fünf Jahre zur Kulturfrontstadt erweckt werden. Von ihr aus sollte der Glanz doppelt freier Kunst, frei von kunsttheoretischen und Staatsnormen und frei von Gegenständlichkeit, weit in die Finsternis des „Ostbereichs“ hinüberstrahlen. Gemessen an ihrem Anspruch waren die ersten Ausstellungen noch nicht einmal Halbweltausstellungen. Den ersten Schritt zu einer auch qualitativen Erweiterung unternahm die Documenta 6 im Jahr 1977 mit der Einladung bisher als „Staatskünstler“ diffamierter Maler aus der DDR. Noch in der Ausstellung „Documenta. Politik und Kunst“, die von Juni 2021 bis Januar 2022 im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen war, spürt man das Erstaunen des damaligen Publikums über die unerwartete Lässigkeit, Diskussionsfreude und rhetorische Eleganz der eingeladenen Künstler aus der DDR. Schneller wurde noch nie ein Klischee zerlegt. Dennoch dauerte es danach noch ein Vierteljahrhundert, bis der Anspruch, Weltausstellung zeitgenössischer Kunst zu sein, nach und nach praktisch wahr wurde. Mit dieser zweiten Öffnung verbunden änderte sich die Haltung zur Politik in zweierlei Hinsicht. An die Stelle des bislang eher latent gehaltenen und zu den eigenen gesellschaftlichen Verhältnissen apologetischen politischen Dispositivs trat eine ausdrückliche Politisierung der Kunst, die sich gegenüber den Macht- und Herrschaftsverhältnissen des „Westens“ bzw. einzelnen Erscheinungsformen dieser Verhältnisse kritisch positionierte. Und diese Art der Politisierung traf zunehmend auf die heftige Abwehr der herrschenden ideologischen Mächte. Ein Bekannter, den ich auf der diesjährigen Documenta getroffen habe, formulierte es, durchaus anerkennend gemeint, so: „Hier werden wir richtig vorgeführt. Hier wird es uns gegeben.“
3.
Der wichtigste Skandal der Documenta, ihr Gründungsskandal, war ein verschleppter und versäumter Skandal. Er blieb jahrzehntelang in der Latenz. Er lässt sich nicht allein mit der Figur der Verkehrung fassen, sondern muss auch als Verdrängung und Verschiebung beschrieben werden. Es geht um den Ko-Gründer der Documenta. In Kassel spricht man von Arnold Bode. Nach ihm sind eine Straße, eine Schule und ein Kunstpreis benannt. Dagegen blieb Dr. Werner Haftmann, kunsttheoretischer Kopf der ersten drei Ausstellungen, Bodes Schatten- und Dunkelmann. Während der Sozialdemokrat Bode bereits 1933 ein Lehramt in Berlin verlor und 1936 Berufsverbot als Künstler bekam, war Haftmann 1933 der SA und 1937 nach Beendigung des Aufnahmestopps der NSDAP beigetreten. 1936 wurde Haftmann Assistent am deutschen Kunsthistorischen Institut in Florenz. In das Gebäude, in dem das nicht-staatliche Institut untergebracht war, zog im Dezember 1940 der emigrierte jüdische Maler Rudolf Levy ein, und zwar in eine Pension über den Räumen des Instituts. Dort müssen die beiden sich begegnet sein. Nach der Besetzung Italiens durch die Wehrmacht konnte sich Levy zwar anfangs einer Verhaftung entziehen, indem er abwechselnd bei Freunden übernachtete. Als er jedoch am 12. Dezember 1943 in seine Wohnung zurückkam, erwartete ihn bereits die Gestapo. Am 30. Januar 1944 wurde er von Mailand aus nach Auschwitz deportiert und starb noch auf dem Transport. Um diese Zeit wurde Haftmann zum XIV. Panzercorps der Wehrmacht versetzt und agierte als ziviler „Sonderführer Z“ im Krieg gegen die italienischen Partisanen. Dort nahm er an Folterungen und Erschießungen teil, was zumindest durch seine Unterschrift unter zwei Vernehmungsprotokolle belegt ist. Darüber hat der in Köln lehrende italienische Historiker Carlo Gentile im Frühsommer 2021 eine größere Öffentlichkeit durch Zeitungsberichte informiert. Nach dem Krieg inszenierte sich Haftmann als passionierter Kenner der klassischen Moderne und machte damit Karriere in den Kunstapparaten der Bundesrepublik. In seiner als Standardwerk geltenden „Malerei im Zwanzigsten Jahrhundert“ (München 1954) behauptete er, „nicht ein einziger der deutschen modernen Maler“ sei Jude gewesen. Dazu passte, dass er die ersten drei Documenta-Ausstellungen, an denen er als Ko-Kurator mitbeteiligt war, vor allem als Promotion des Werkes Emil Noldes verstand, der als Exponent der „nordischen Moderne“ trotz „Malverbot“ dem NS-Regime verbunden geblieben war und bis zu dessen Ende gute Geschäfte machen konnte. Noldes Inszenierung als „Verfolgter“ gehört zur postfaschistischen Legendenbildung. Haftmanns Falschaussage über die Rolle der Juden in der Geschichte der modernen Malerei erfolgte nicht nur wider besseres Wissen. Haftmann bemühte sich auch, ihr durch eigenes Agieren zumindest den Anschein von Plausibilität zu geben. Die Berliner Ausstellung hat nämlich dokumentiert, dass Rudolf Levy auf der ersten Documenta mit Bildern vertreten sein sollte, sein Name aber dann von der Liste der vorgesehenen Exponate gestrichen wurde. Das erging nicht allen jüdischen Malerinnen und Malern so, aber stets solchen, die von den Nazis umgebracht worden waren. Ausstellungen ihrer Bilder hätten Hinweise auf den Holocaust notwendig gemacht und dies sollte unter allen Umständen vermieden werden.
Die Kollaboration von Bode und Haftmann ist kein Einzelfall, sondern exemplarisch für die Zusammensetzung der „Eliten“ der Bundesrepublik in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen. 1954 schrieb Thomas Mann über das Klima in der jungen Bundesrepublik: „Ich kenne die Unverschämtheit der jungen Generation da drüben. Sie hängt auch wohl mit der lächerlichen Wirtschaftsblüte der amerikanischen Lieblingskolonie ‚Westdeutschland‘ zusammen, diesem frechen und unmoralischen Wohlsein nach Schandtaten, die mit der Höllenfahrt nach 1945 schlossen, und an die heute zu erinnern nichts weiter als bolschewistisch ist.“ Wer das als atmosphärische Impression abtut, kann bei Dominik Rigoll die akribisch recherchierten Fakten nachlesen: 1949 konstituierte sich die westdeutsche „Elite“ aus wenigen ‚Unbelasteten‘ und aus einer erdrückenden Mehrheit vormals entlassener, 1949 amnestierter und rehabilitierter (Ex-) Nazis. Ihr Pakt beruhte auf dem ‚kommunikativen Beschweigen‘ der Verbrechen unter der Nazi-Herrschaft, einem Beschweigen, das die Diffamierung und Beleidigung von Emigrierten und Menschen im Widerstand nicht ausschloss. Gefährdet war dieser verlogene Pakt einzig durch die Minderheit von Kommunisten und anderen Linken, die keinen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen, sondern aus ihr Lehren für Gegenwart und Zukunft ziehen wollten. Wer gegen das Schweigeverbot verstieß, musste mundtot gemacht werden, und das nicht nur aus ideologischen Gründen, sondern auch, weil er die materiellen Interessen der in ihre alten oder in höhere Positionen eingerückten faschistisch belasteten Teile der „Elite“ durch das Veröffentlichen ihrer Verstrickung in die NS-Verbrechen gefährden konnte. Da keine andere herrschenden Klasse in den westlichen Demokratien dermaßen durch Verbrechen diskreditiert war wie die deutsche, war ihr Hass und ihr Verfolgungsfuror gegen links noch blindwütiger, als dies beispielsweise in den USA selbst in den dunkelsten Tagen der McCarthy-Ära der Fall war.[iii]
Dieser Drang zur Immunisierung der Ex-Nazis gegen jede Kritik wirkt über ihren Tod hinaus. Ausgerechnet am Tag der Diskussion über die Rolle Haftmanns im Rahmen der Berliner Documenta-Ausstellung hat die Redaktion der FAZ eine Apologetik veröffentlicht (13.11.2021). Ohne selbst Historiker zu sein, rückt Lothar Sickel Haftmanns Beteiligung an Folter und Hinrichtungen in den Bereich von Behauptungen und Vermutungen und ignoriert dabei, dass Gentile eben dies mit Dokumenten belegt hat. Zur Relativierung dieser Fakten gesellt sich ein Legitimationsmuster, das schon anderweitig, z.B. von Paul Celan, gründlich zerlegt worden ist. Nachdem Sickel die Schilderungen der widerwärtigen Libertinage eines deutschen Herrenmenschen in einem verbündeten und später besetzten Land als Ausweis seiner angeblichen Distanz zum NS-Regime zu verkaufen versucht hat, zieht er zur finalen Klimax seiner Apologie die Karte von Haftmanns „Hinwendung zur Moderne“. Diese kann nur jemand für einen Trumpf halten, der Georg Lukácsʼ Expressionismuskritik oder Walter Benjamins Ausführungen über die herzliche Verbindung von italienischem Faschismus und Futurismus nicht kennt oder nicht zur Kenntnis nehmen will. Nebenbei: Dies war nur eine Einübung in Entschuldungsmuster, die die FAZ ein Vierteljahr später mit unverhohlenem Zynismus auf die Beurteilung des ukrainischen Faschistenführers Stepan Bandera anwandte.
Angesichts solcher Befunde erscheint die Fokussierung der Antisemitismus-Kritik auf einen angeblichen linken und einen islamischen Antisemitismus als ziemlich durchsichtiges, gleichwohl nicht erfolgloses ideologisches Manöver zur Ablenkung von den deutschen Verbrechen. Es handelt sich um eine Aufmerksamkeitsverschiebung auf Gruppen, die den Faschismus am entschiedensten bekämpfen, bzw. auf Gruppen, denen man einiges vorwerfen könnte, nur nicht, dass sie jüdisches Leben durch Pogrome oder Genozid bedroht hätten. So ließe sich mit der Bibel über die sog. Antisemitismusdebatten zur Documenta 15 sagen: Man suchte verzweifelt nach dem Splitter in den Augen der (post-kolonialen) Anderen, um über den Balken im eigenen Auge schweigen zu können. Vordergründig dienen die hochgespielten Antisemitismus-Vorwürfe dazu, die Kritik an der israelischen Staatspolitik gegenüber den Palästinensern unter Tabu zu stellen. Dabei erweist sich die Behauptung, dass „Israelkritik“ selbstverständlich „erlaubt“ sei, fast immer als bedeutungslose Floskel, weil nahezu jede konkrete Kritik dem Vorwurf subsumiert wird, „israelbezogener Antisemitismus“ zu sein. Bekanntlich fällt jetzt schon darunter, wenn die Verhältnisse in Israel mit dem Begriff der Apartheid belegt werden. Verdrängt wird, dass der damalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) im März 2012 bei einem Besuch in Hebron die dort herrschenden Zustände als „Apartheid-System“ eigener Art kennzeichnete. Solche Kennzeichnung lässt sich auch in israelischen Zeitungen wie „Haaretz“ und bei israelischen Menschenrechtsorganisationen finden. Zwei ehemalige Botschafter Israels in Südafrika, Ilan Baruch und Aron Liel, haben jüngst an den deutschen Ökumenischen Rat der Kirchen appelliert, die Zustände in den besetzten palästinensischen Gebieten Westjordanlands und in Ost-Jerusalem als „Apartheid“ zu verurteilen (Berliner Zeitung, 06.09.2022). Während der israelische Soziologe, Historiker und Philosoph Moshe Zuckermann vor einer Verhunzung der Antisemitismuskritik dadurch warnt, „dass man noch nicht begriffen hat, dass Israel, Zionismus und Judentum drei paar Schuhe sind“(Deutschlandfunk Kultur, 25.04.2022), zwängt die hegemoniale deutsche Antisemitismuskritik alles in einen Stiefel hinein. In der letzten Bezichtigungswelle gegen die Documenta erhob die oben erwähnte „Expertenkommission“ anlässlich dreier palästinensischer Propagandafilme gegen die künstlerische Leitung den Vorwurf, eine „antizionistische, antisemitische und israelfeindliche Stimmung“ zugelassen zu haben. Die deutsche Kuratorin Dorothee Richter sprang der „Expertenkommission“ bei und sprach in ihrem Interview mit der FR vom 15.09.2022 relativierend von Israels „sogenannten besetzten Gebieten“. Der Kontext ihres Interviews legt die Befürchtung nahe, dass jeder, der im Klartext von besetzten Gebieten redet, und das tun neben den erwähnten Stimmen u.a. auch der UN-Menschenrechtsrat und das US State Department, mit dem Vorwurf der „Israelfeindlichkeit“ zu rechnen hat. Man kann verstehen, dass jüdische Gemeinden hierzulande Israel fast bedingungslos verteidigen, aber es irritiert, wenn sie dabei das alte deutsche Spiel hinnehmen, wonach die Enkel und Urenkel der Nazis immer noch darüber bestimmen wollen, wer guter und wer schlechter Jude ist. Geschichtsblind scheint mir auch der Glaube zu sein, in der postnazistisch sozialisierten deutschen „Elite“ von heute einen verlässlichen Schutz gegen Antisemitismus gefunden zu haben.
4.
Wenn somit über den weitgehend projektiven Charakter der medialen Schelte der Documenta 15 das Wichtigste gesagt ist, wäre doch noch nicht alles gesagt, was gesagt werden muss. Nicht alles, was vorgetragen wurde, ist Projektion. Dies gilt für den Ausschnitt aus dem verhängten und dann entfernten Banner People’s Justice des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi, der ein Gesicht mit Haifischzähnen, Melone mit SS-Runen und den Schläfenlocken ultra-orthodoxer Juden zeigt. Mit Recht hat die israelische Journalistin Shany Littman in einem Beitrag für „Haaretz“, der von der Berliner Zeitung vom 29. 06. 2022 übersetzt und übernommen worden ist, dieses ikonische Amalgam ein wirres, antisemitisches Bild genannt. „Es ist da, es lässt sich nicht leugnen.“ Versuche, es quasi-magisch zu exorzieren, sei es durch Blindstellerei (die Schläfenlocken werden in akribischen Beschreibungen des Bildausschnittes nicht erwähnt), durch Verkleinerung (es seien doch nur „Konturen von Schläfenlocken“) oder Interpretation, sind schlicht hilflos, um das mindeste zu sagen. Was die Interpretation leisten soll, macht die rhetorische Frage eines „Offenen Briefes“ deutlich: „Steht das etwa für den ‚hassenswerten, raffgierigen Juden‘ oder einen gewieften Makler, der symbolhaft das Finanzkapital repräsentiert, das die Reichtümer und Bodenschätze der Länder der ‚Dritten Welt‘ an der Börse verhökert?“ Die darauf folgende Antwort lautet: „Jedenfalls sind beide inkriminierten Bildausschnitte kein antisemitisches Werk, sondern strikt anti-suhartoistisch intendiert.“ Was der Bildausschnitt ikonisch zusammenfügt, reißen die Autoren zu einer Entweder-Oder-Alternative auseinander, ohne ihren Vereindeutigungszwang auch nur im Ansatz zu begründen. Dabei legt gerade die wirre Verschmelzung der Bildelemente nahe, dass dadurch eben die Kritik des Finanzkapitalismus durch die Schläfenlocken antisemitisch markiert und das Klischee des ‚jüdischen Finanzkapitals‘ reproduziert wird, dass sich also die wichtige und nötige Kritik am Terrorregime Suhartos punktuell antisemitischer Bildmittel bedient. Darauf träfe somit präzise die klassische Definition des Antisemitismus durch August Bebel zu: Antisemitismus ist der Antikapitalismus der dummen Kerls!
5.
Die hier beobachtbare Diffusion von kolonialistisch tradierter antisemitischer Bildlichkeit und antikolonialistischen Intentionen gibt Grund, einen genaueren Blick auf die Abstraktion „globaler Süden“ zu werfen. Zu konstatieren wäre zunächst, dass die Öffnung der Documenta für Werke aus diesem Süden parallel zu seinem ökonomischen Aufstieg erfolgt. 1980 betrug der Anteil des kapitalistischen Nord-Westens und Japans am Welt -BIP 76 %, der der Entwicklungsländer und der postsowjetischen Staaten 24 % (zu lfd. USD). Der Anteil Chinas betrug damals 2%. „Globalisierung“ war bis zur Jahrtausendwende wesentlich bestimmt von der Triade Nordamerika, EU und Japan. Im Documenta-Jahr 2002 sah das Verhältnis bereits so aus: Auf die kapitalistischen „advanced economies“ entfielen 56% des Welt-BIP, auf die Entwicklungs- und Schwellenländer bereits 38%. Keiner redete jetzt mehr von Japan (Welt-BIP-Anteil 7%), immer mehr redeten von China (12%). Der neueste „World Economic Outlook“ des Internationalen Währungsfonds, der diese Daten jährlich vorlegt, notiert für das Jahr 2021 folgende Relation: Auf die entwickelten kapitalistischen Ökonomien entfallen nur noch 42%, auf die Entwicklungs- und Schwellenländer 58%. Das ist gemeint, wenn vom Aufstieg des „globalen Südens“ und seinen Fortschritten die Rede ist.
Schaut man genauer hin, wird der ökonomische Aufstieg des „globalen Südens“ von einer Gruppe von neun Schwellenländern vorangetrieben, die auch der Gruppe der G-20 angehören, und einigen weiteren. Sechs von ihnen bilden die BRICS-Gruppe. Das wirtschaftlich stärkste Land ist die VR China. Dabei ist strittig, ob man China noch dem „globalen Süden“ zurechnen bzw. als „Schwellenland“ bezeichnen kann. Damit ist der erste Grund der Kritik am Begriff des „globalen Südens“ genannt. Er verdeckt die Heterogenität zwischen den darunter gefassten Ländern, denn zu den 156 Ländern, die der IWF als Schwellen- und Entwicklungsländer zählt, gehören auch die aktuell 46 am wenigsten entwickelten Länder (LDC). Beispielhaft sind hier Haiti und Mali zu nennen, die durch Kollektive auf der Documenta 15 vertreten waren. Auf sie entfallen je 0,025% und 0,035% Anteile am Welt-BIP, während Deutschlands Anteil mit 3,3% 132 bzw. 94 Mal so hoch ist. Zu dieser Indifferenz gegenüber ökonomischen Unterschieden kommt die Blindheit gegenüber beträchtlicher sozialer Ungleichheit in den am weitesten entwickelten Ländern des Südens. Eine prominente Gedankenform, die die innere soziale Polarisierung verdeckt oder erst in zweiter Linie beachtet, bilden sog. postkoloniale bzw. identitätspolitische Ideologien. So stellt Achille Mbembe den von ihm so genannten „Identitätsurteilen“ der Kolonialherren über die von ihnen Unterworfenen (z. B. faul, widerspenstig, tückisch usw.) die „Identitätserklärungen“ der (Post-)Kolonisierten gegenüber, die sie dazu befähigen können, Akteure im politischen Prozess zu werden. Das dazu erforderliche Geschichtsbewusstsein sollen sie durch das Anlegen von Archiven erlangen, in denen die mühsam gesammelten Fragmente und Spuren der eigenen Geschichte bewahrt und der Reflexion zur Verfügung gestellt werden.[iv] Solche Ansichten, die die Kolonisierten immer nur als Einheit sehen, dominierten die Künstlerideologien und die kunsttheoretischen Interpretationen der Exponate der diesjährigen Documenta. Sie sind erfahrungshaltig, wenn sie neokolonialistische Herrschaftsverhältnisse namhaft machen, versagen aber gegenüber ausgeprägten inneren Herrschaftsbeziehungen. Man kann sich das an einem unscheinbaren Sachverhalt klarmachen. Das südkoreanische Forschungsprojekt ikkibawiKrrr stellte unter dem Titel Monument Blöcke aus jenen Gesteinsarten aus, die unter der japanischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg von koreanischen und indigenen Zwangsarbeitern abgebaut werden mussten. Die Ausstellung wurde gefördert von Korean Foundation und der Samsung Foundation of Culture. Bis zum Tod des Firmengründers Lee Byung Chul 2020 galt bei Samsung die Maxime: Gewerkschaften – „nur über meine Leiche“. Danach hat sein Enkel diese Konzernregel verabschiedet. Der erste Streik in der Firmengeschichte fand dann im Juni 2021 bei Samsung Display statt. Die Stiftung sieht offenbar zurecht die Firmeninteressen durch Förderung des genannten Exponates nicht beeinträchtigt.
Auf der anderen Seite des Spektrum wäre Taring Padi zu verorten, denen Hans Eichel, früherer Kasseler Oberbürgermeister, hessischer Ministerpräsident und Finanzminister unter der Kanzlerschaft Schröders, attestierte, sie seien „keine Antisemiten, sie sind eher Klassenkämpfer und leiden in Indonesien unter den erstarkenden Islamisten“(FR, 18.07.2022).
Trotz solcher Gegensätze, Entwicklungsunterschiede und politischer Differenzen besitzt der Begriff des „globalen Südens“ auch darin einen Erfahrungsbezug und ein relatives Recht, als diese Länder gegenüber dem „globalen Norden/Westen“ zumindest ein gemeinsames weltwirtschaftliches und geopolitisches Interesse teilen, das, wie die letzten Monate gezeigt haben, stark genug ist, um auch erheblichem Druck standzuhalten.
6.
Zu einer komplexen Beurteilung des wirtschaftlichen Aufstiegs der Länder des Südens gehört weiterhin auch die Berücksichtigung der Stärken der bisherigen Hegemonialmacht USA. Zu ihnen zählen die militärische Dominanz, auch noch die Dominanz im Währungs- und Finanzbereich, z.T. in der digitalen Technologie, vor allem aber ist in unserem Kontext die USA-Hegemonie in der (Massen-)Kultur von Bedeutung. Sie manifestiert sich nicht so sehr auf dem Kunstmarkt, in dem 43% der Marktanteile auf die USA entfallen, aber bereits 20% auf die VR China (17% auf Großbritannien und 7% auf Frankreich), als vielmehr in der Vorherrschaft US-amerikanischer Medienkonzerne. Von den 50 weltweit größten Medien- und Wissenskonzernen haben 26 ihren Stammsitz in den USA, unter den ersten zehn sind es sieben. Dies ist bis heute die materielle Grundlage von Hermann L. Gremlizas These aus dem Jahr 1993 über die Aufklärungszerstörung und die Verbreitung von Irrationalismus nach dem Kollaps des europäisch-sowjetischen Sozialismus: „… nie waren so viele Menschen so hoffnungslos dem frühen Tod durch Hunger und Seuchen ausgeliefert. Überall hat Aberglaube, haben Buddhismus, Islam, Christentum und andere Sekten sciento- oder ökologischer Art Anfänge oder Reste von Aufklärung verdrängt. …[Für die Massen des „Südens“ ist] mit dem Kommunismus … ihre einzige, letzte Hoffnung auf eigene Entwicklung verschwunden; sie wurden zurückgestoßen in Analphabetentum, in Krankheit, in ihre Stämme, die sie, im Kampf ums Überleben, zu Räuberbanden modernisiert haben.“ (Letzte Ausfahrt Mogadischu, konkret 2/1993).
7.
Bevor ich darauf zurückkomme, ist ein genauerer Blick auf die unterschiedlichen Typen der auf der Documenta vorherrschenden Ausstellungssubjekte, die Kollektive, zu werfen. Die hiesige Kunstkritik spricht von der Documenta 15 als einer „Schau der Kollektive“. Diese realisierten „kollektivistische Ideen, die „die Ideologie von Autorschaft und Autorität innerhalb der Kunst“ hinterfragten, die „Gemeinschaftlichkeit“ zum „Produktionsprinzip der Kunst“ erhöben und einen „mehr als nur erweiterten Kunstbegriff“ verträten (Kunstforum 283: documenta fifteen, S.66, 82, 93, 100). Solche Etikette ignorieren die unterschiedlichen Gründe der Kollektivbildung. Ein Großteil der Kollektive ist aus der Not geboren. Sie wollen erst die Voraussetzungen für nachhaltiges künstlerisches Produzieren schaffen. Kollektivität und die Fähigkeit, vielfältige Arbeiten zu übernehmen, resultieren aus der Vielfalt der Arbeiten und der daran gemessen relativ geringen Zahl der Akteure im Kollektiv. Eine Ausdifferenzierung ästhetischer Praxen und Apparate liegt z.T. noch vor ihnen. Zutreffend spricht Ingo Arend von „Protokunst“ (Kunstforum, S. 102). Exemplarisch ist hier die Fondation Festival sur le Niger zu nennen. Der Stiftung geht es darum, das kulturelle Leben Ségous, einer Stadt am Niger und 235 km nordöstlich von Bamako gelegen, zu stärken und „die Abwanderung junger Künstler*innen in die Hauptstadt Bamako oder ins Ausland zu stoppen“. „Indem sie junge Künstler*innen und Kulturunternehmer*innen aus ganz Afrika ausbildet, sie bei der Produktion künstlerischer Arbeiten und dem Aufbau von Vertriebswegen intensiv betreut und unterstützt, stärkt die Fondation sur le Niger das gesamte Spektrum aus Kunst und Kultur in Mali und darüber hinaus.“ (Siehe Link in Endnote 1.) Vor einer ähnlichen Situation stehen Projekte unterprivilegierter Minderheiten in entwickelten Ländern. Um deren Interessen geht es z. B. dem Budapester Projekt OFF-Biennale, das bei fehlender bzw. ausgeschlagener staatlicher Förderung Unabhängigkeit und Widerstandskraft von Roma-Künstler/innen und den Aufbau eines Roma Museum of Contemporary Art ermöglichen will. Vielfach sind Kunst und ästhetische Praktiken eingebunden in Projekte landwirtschaftlicher Modernisierung oder von Geschäftsgründungen, klassisch aber auch als Mittel der Sozialpädagogik. Wenn das Wajukuu Art Project in einem Slum Nairobis das Selbstbewusstsein arbeitsloser Jugendlicher durch Kunst stärken will, um sie berufsfähig zu machen, und für seine Kunstprojekte Materialien aus der nahegelegenen Müllkippe sammelt, ist das kein verpflanzter Dadaismus, sondern es funktioniert damit eine Lebenswelt um, in der die Jugendlichen tagein, tagaus nach Verwertbarem suchen.
Der Zwang zur Kollektivbildung resultiert nicht immer allein aus ökonomischem Mangel. Ein Teil der Materialnot ist auch politisch begründet oder wird durch die politische Lage erzeugt bzw. die künstlerischen Mittel werden unter dem Aspekt antizipierter Illegalität gewählt. Darauf machte z.B. das Plakat „Smuggling Paint into Gaza“ aufmerksam. Ein Künstler von Taring Padi begründet seine Vorliebe fürs Malen mit Kugelschreiber damit, dass Kugelschreiber billig und überall zu bekommen sind.
Mit Taring Padi ist auch ein zweiter Typ der Kollektivbildung angesprochen. Ein geringer Teil der ausgestellten ästhetischen Produktionen, nämlich großflächige politische Propagandakunst (Banner), aber auch ihre Verteilung (nächtliches Plakatkleben), erfordert kollektives Agieren. Hier sind unbedingt die Filme über Taring Padi zu erwähnen, die im Eingangsbereich der Ausstellung im Hallenbad Ost zu sehen waren. Sie gehörten zu den informativsten Kommentierungen der ansonsten schwachen Beschreibungen der ausstellenden Kollektive und ihrer Arbeitsbedingungen und Ziele. Manche Äußerungen der Künstler sind Englisch untertitelt. Ein australischer Film wird von einem englischsprechenden Bericht begleitet. Leider war der Hintergrundtext akustisch kaum zu verstehen. Dem Film wäre unbedingt zu wünschen, im Zuge einer Nachbereitung der Documenta unter technisch verbesserten Bedingungen ins Netz gestellt zu werden.
Eine besondere Form der Kooperation präsentierte das britische Project Art Works, das sein Atelier nach Kassel ins Fridericianum verlegt hatte. Es geht diesem Projekt um die Unterstützung „neurodiverser“ Kinder und Künstler und im weiteren Sinn um die Verbesserung der Unterstützungsarbeit mit diesen Menschen („Care“). Wie das funktionieren kann, zeigte die Zusammenarbeit zwischen dem künstlerischen Leiter des Projekts, Tim Corrigan, und einer jungen Kasseler Grafikdesignerin, die an einer fortschreitenden Muskelschwäche leidet. Ihren Wunsch, ein großformatiges Kunstwerk zu erstellen, obwohl ihr für die Arbeit mit dem Pinsel die Kraft fehlt, realisierte sie dadurch, dass sie mit einem Laserpointer die Konturen auf der Leinwand markierte, die Corrigan mit dem Pinsel auftrug und die Flächen dann nach den Wünschen der Frau ausmalte. Man kann das assistierte Autonomie nennen, die es den derart behinderten Menschen ermöglicht, „eine Spur zu hinterlassen“, wie es die Gründerin des Projektes Kate Adams formuliert. Ohne Kooperation wäre dies unmöglich.[v]
8.
Als dritter Typ ist der Großteil der Kollektive zu nennen, die mit postkolonialen und identitätspolitischen Maximen arbeiten. Auf deren Problematik wurde bereits verwiesen. Quer dazu steht die Unterscheidung zwischen Kollektiven, die eine „Identitätserklärung“ primär durch die Erschließung von Spuren und Fragmenten der Unterdrückungsgeschichte der einst Kolonisierten erreichen wollen, und solchen, die den Weg der Wiederbelebung vor-kolonialer Mythen und Religionen einschlagen. Wie auch immer, solche Kollektive weisen meist eine Kooperation zwischen Künstlern, Gesellschaftswissenschaftlern, Historikern, politischen Aktivisten oder religiösen Akteuren auf. Geschichts- oder auch Herkunftsbewusstsein wird zur Grundlage ästhetischer Praxis, liefert ihr den Stoff, den es zu bearbeiten gilt. In diesen Zusammenhang gestellt, erstaunt es dann nicht mehr, dass das „Herzstück“ einer Weltkunstausstellung, das Fridericianum, zum Standort von Kollektiven wurde, die sich primär um die Aneignung von Geschichte kümmern. Sie stellten keine Kunstwerke aus, sondern Bücher und Dokumente. Sie arbeiten an einer aufklärerischen Geschichtsschreibung in praktischer Absicht und dies nicht nur im Blick auf ästhetisches Schaffen. Sie bewahren die bruchstückhaft überlieferte Geschichte der Unteren so, wie es Walter Benjamin sich erhofft hat: als Geschichte von Zuversicht, Mut, Humor, List und Standhaftigkeit. Es nimmt nicht Wunder, dass unter ihnen die Archives des luttes des femmes en Algérie zum Objekt einer herrschaftskonform halbierten Antisemitismuskritik wurden, die hier jedoch wegen ihrer offenkundigen Haltlosigkeit ins Leere ging.
Allerdings gab es deutlich mehr Kollektive, die die mühsame Suche nach Spuren der Geschichte der Unterdrückten auf die Ausgrabung vorkolonialer Mythen und Religionen verengen und sich von ihrer Wiederbelebung eine Stärkung ihrer Identität im Widerstand gegen die weiße Herrschaft erhoffen. So verfuhren die Kollektive der Maori, der Aborigines und aus Haiti, und das ist noch lange nicht das Ende. Selbst auf der Skateboardrampe von Mr. Wilson sollte man auf Inspiration durch „Götter, Dämonen und Milchwirtschaft“ hoffen dürfen.
Es geht mir nicht darum, diese Projekte durch Blütenlesen vorzuführen. Das Hauptproblem besteht darin, dass im Prinzip fast alle Exponate und ihre Produzenten nur mangelhaft kommentiert und vorgestellt werden und so zu Projektionsflächen hiesiger Sehnsüchte, vorschneller Schlüsse und mentaler Eingemeindung werden konnten. Das fällt umso mehr ins Gewicht, als die Länder des „globalen Südens“ in der Berichterstattung der hiesigen Medien gemessen an ihrer Bevölkerungszahl und ihrer geopolitischen Bedeutung dramatisch unterrepräsentiert sind.[vi] Unter solchen Informationsbedingungen ist es ratsam, mit Be- und Verurteilungen zurückhaltend zu sein. Die Ausschläge solcher Urteile konnte man an der disparaten Rezeption der Exponate des Kollektivs Atis Rezistans aus Haiti beobachten. Zum einen traf die Ausstellung menschlicher Schädel und Skelettteile in der Realienmontage von Skulpturen in der seit drei Jahren nicht benutzbaren und für Documenta-Zwecke teilsanierten katholischen Kirche St. Kunigundis noch auf das Bedenken konservativer Katholiken. Schnell aber zeigten sich viele Besucher/innen begeistert und der Gemeindepriester freute sich darüber, dass im Vorraum der Kirche noch nie so viele Kerzen zum Anzünden nachgelegt werden mussten wie zur Documenta-Zeit. So nutzten „die spirituellen Energien“ des Voodoo, die vor allem in der Beschriftung der Exponate beschworen wurden, auch dem Katholizismus. Schwer auszumachen, ob es an den Objekten oder an ihrer Kommentierung lag, aber auf diese Weise wurde potentielle Kritik verträglich gemacht, wurde zum Gegenstand von Zerstreuung oder eben von geistiger Sammlung und Einkehr.
9.
Die Documenta zeigte bestimmt nicht den Blick des globalen Südens auf den globalen Norden und Westen, aber einige seiner kritischen Facetten. Sie hielt den ehemaligen Kolonialherren und ihren neokolonialistischen Nachfolgern den Spiegel vor. Sie zeigte damit auch den „globalen Süden“ in seiner ganzen Widersprüchlichkeit von ökonomischen Fortschritten, politischer Reaktion und kultureller Regression. Die Konzepte einer autonomen, auratischen Kunst wurden nicht mit Gegenkonzepten eines wie und wohin auch immer erweiterten Kunstbegriffs konfrontiert. Vielmehr legten die Exponate die Frage nahe, ob solche Konzepte überhaupt den erschließbaren oder vermuteten Entstehungsbedingungen der ausgestellten Objekte angemessen sind. Wenn es vorerst um den Aufbau künstlerischer Apparate geht und um die damit verbundenen Mühen, die unvermeidlichen Umwege, die dabei genommen werden, und die Sackgassen, in die man gerät, werden ästhetische Begriffe, die auf eine mehr als 500 jährige Geschichte der Institutionalisierung von Kunst in europäischen Kontexten zurückweisen, schief, sofern man sie normativ verabsolutiert.
Diese Unvollkommenheit und Prozesshaftigkeit kommen den Bedürfnissen eines Publikums entgegen, das sich nicht in Werke versenken will, sondern Aktivität, Beteiligtsein, Anfassen-Dürfen und Ausprobieren-Können der Kontemplation vorzieht. Damit sollen vor allem die Kinder angesprochen werden, denen man nicht früh genug eine idealerweise mühe- und kostenlose ästhetische Erziehung angedeihen lassen will. Dies erklärt, warum Gudskul für Rurukids im Fridericianum zu den großen Anziehungspunkten der documenta 15 wurde, wie auch die Kinderkrippe in der Fridskul für Eltern von Kindern im Alter von 0 bis drei Jahren. Die Eltern lobten die Kinderkrippe als „kreative und achtsame Alternative zum Spielplatz“. Die Stadt solle sie doch bitte nach der Documenta aufkaufen. Gedanken über die Folgekosten, etwa Personalkosten, hatten sich die solches fordernden Eltern nicht gemacht. Warum auch? Die Stadt lehnte lakonisch ab und klärte auf: Es handle sich „nicht um eine Kunstinstallation im Sinne der Ankäufe für die von der Neuen Galerie betreute städtische Kunstsammlung“ (HNA, 05.09.2022).
Wie auch immer die Zukunft der Documenta aussehen wird, eine Rückkehr zum Status quo ante wird es auf keinen Fall geben, keine Rückkehr zu einer Kunst, die Paul Celan als „Kunst-Kunst“, „Artistik“ und „keimfreie ästhetische Botschaften“ kritisiert hat. Einer solchen aseptischen Kunst ist schlicht das Publikum abhandengekommen. Das Documenta-Publikum besteht seit langem nicht mehr aus dem alten Bildungsbürgertum, aus Mensur gezeichneten Anwälten oder Ärzten, die in den Behandlungszimmern Konsaliks „Arzt von Stalingrad“ auf den Renommierplatz im Regal stellten, weil sie das für den einsamen Höhepunkt westdeutscher Gegenwartsliteratur hielten. Das heutige Publikum besteht zum großen Teil aus den Angehörigen einer zur Massenschicht angewachsenen Intelligenz. Und obwohl diese Schicht die vorerst stabile Wählerbasis der „grünen“ Partei bildet, werden sich die Angehörigen dieser Schicht nicht von Claudia Roth die Gelegenheit nehmen lassen, folgenlos ihr schlechtes Gewissen beruhigen zu können, wenn sie den „total spannenden“ oder „völlig irren“ Kunstwerken aus dem Süden ihren Respekt erweisen. So lässt es sich gut öko-imperial leben.
Auch die Öffnung zu den Ländern des „globalen Südens“ wird bleiben. Solange es nicht zu einer ökonomischen Entkopplung der Weltblöcke kommt, die unabsehbare negative Folgen hätte, aber immerhin nicht undenkbar wäre, wird auch eine kulturelle ausbleiben. Je gewichtiger der „globale Süden“ wird, zumal wenn es hier und dort gelingt, ökonomischen Aufstieg mit gesellschaftlichem Fortschritt und individueller Emanzipation zu verbinden, desto unwahrscheinlicher wird ein „Decoupling“ in Kultur und Kunst. Jürgen Raaps Befürchtung einer „Documenta-Dämmerung“ (Kunstforum 283, S. 106 ff.) beruht auf der Rezeption von Medien- und Politikerreaktionen. Die Abstimmung des Publikums konnte er noch nicht auf dem Zettel haben. Schon zur Mitte der Documenta war absehbar, dass die Besucherzahlen keineswegs dramatisch eingebrochen sind. Daher geht man kein großes Risiko ein, wenn man die Prognose wagt, dass mit „Documenta-Dämmerung“ nur eine Morgendämmerung gemeint sein kann. Diese wird wie jede anständige Morgenstunde ihre Lumpensammler finden.
[i]https://documenta-fifteen.de/lumbung-member-kuenstlerinnen/?order=abc
Die Liste gibt Einblicke in die Arbeit und Ziele der Kollektive und Künstler/innen.
[ii] Art Basel/UBS: The Art Market 2022. https://www.artbasel.com/about/initiatives/the-art-market
[iii] Dominik Rigoll: Staatsschutz in Westdeutschland. Von der Entnazifizierung bis zur Extremistenabwehr. Göttingen 2013. Thomas Manns Brief an Klaus Mampell datiert vom 17. Mai 1954.
[iv] Achille Mbembe: Kritik der Schwarzen Vernunft. Berlin 2014 (Orig. frz. 2013), hier S. 64 f.
[v] Zu sehen im Magazin Twist bei Arte: Documenta 15: Was bleibt? https://www.arte.tv/de/videos/105617-007-A/twist/ , ab Minute 3:49.
[vi] Siehe hierzu Ladislaus Ludescher: Vergessene Welten und blinde Flecken. Die mediale Vernachlässigung des Globalen Südens. Universitäts-Bibliothek Heidelberg 2020. Kostenloser download: https://books.ub.uni-heidelberg.de/heibooks/catalog/book/599

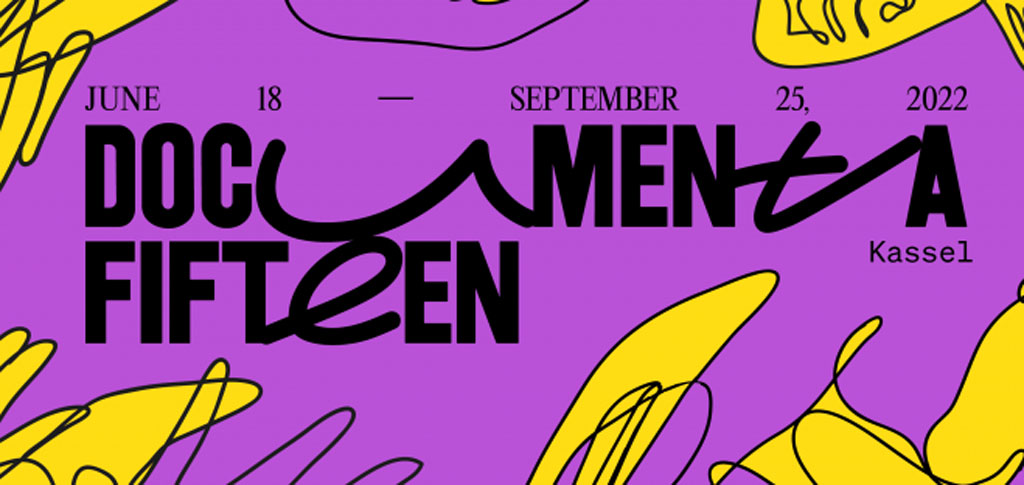














 Unser Blog lebt durch Sie!
Unser Blog lebt durch Sie!