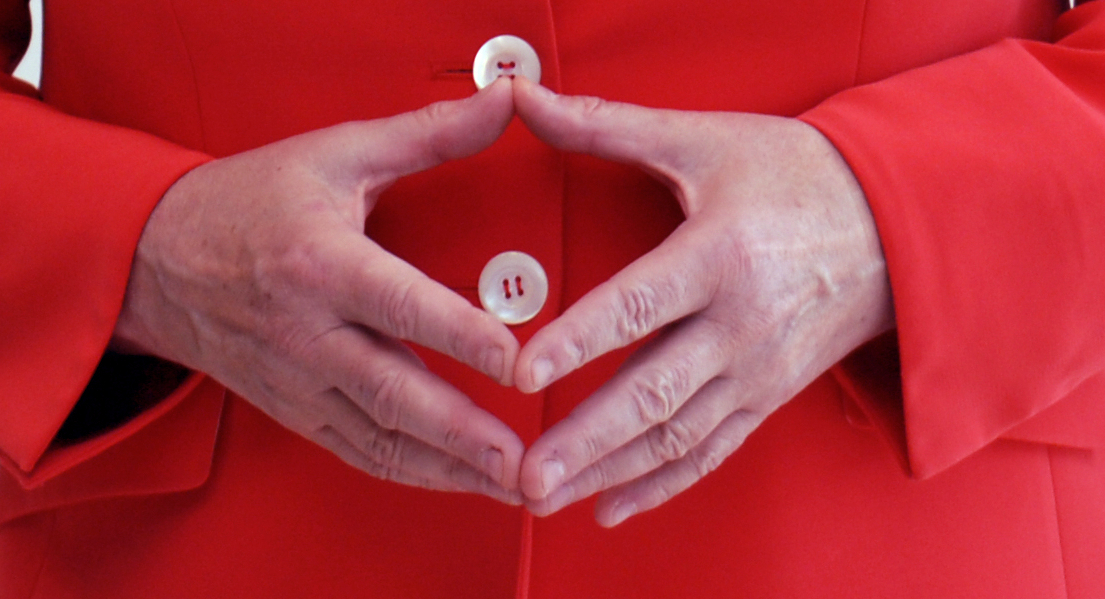Es gibt jetzt in der Martinszeit und auch sonst, im Rheinland und auch anderswo, viele bunte Laternen: „rote, gelbe, grüne, blaue; lieber Martin, komm und schaue“. So singen die Kinder jedenfalls hier in Bonn. Wir hoffen, dass das auch jetzt im November des Coronajahres 2021 so ist. Das sind noch richtige, ehrliche Farben, denn die Kinder, die sie tragen, sind noch ehrliche Menschen! Verdorbene Snobs ab sechzehn Jahren Alter zeihen sie als naiv, aber in Wahrheit sind sie nur guten Glaubens. A propos Guter Glaube: Ich ging als laternetragender Stöpsel in Norddeutschland natürlich fest davon aus, es werde unser guter Dr. Martin Luther geehrt, der vermutlich einen Tag später Geburtstag habe. Gerade Irrtum kann ja rührend sein!
A propos Ehrlichkeit könnte man jetzt das Blau brüsk aus dem Spiel lassen und über die Ampelkoalitionäre plaudern, aber die geben sich momentan so bedeckt, das es nichts zu karikieren gibt. Deshalb – Schuster bleib bei deinen Leisten – betrachten wir die Sache sprachlich.
Hinsichtlich der Leuchtmittelbuntheit gibt es jedenfalls keine beigen, ultramarinen, orangenen, indigonen oder pinken Laternen – igittigitt! –, und das durchaus nicht aus Mangel an schönen und kindgerechten Reimen. Es geht nämlich sprachlich nicht, und trotzdem reden manche Leute so: Wer um Gottes Willen hat eigentlich auf Deutsch den haarsträubenden Begriff „orangene“ oder „orange Revolution“ über die Ereignisse in der Ukraine 2004 durchgesetzt, beides falsch wie Gift?(Ich meine natürlich nicht die Sache selbst.) Schon beim Klang rollen sich doch jedem empfindsamen Menschen die Fußnägel auf! Wenn, dann muss das „orangefarbene Revolution“ heißen!
Die in der Regel aus dem Französischen stammenden Farbbezeichnungen zum Beispiel der Modewelt – aber nicht nur – sind nämlich im Deutschen nicht so einfach prêt-à-porter wie normale Eigenschaftswörter. Schon die Urgroßmüttergeneration der bis zum Ersten Weltkrieg Herangewachsenen verwendete für Gewand und Schuhwerk bevorzugt fremde Wörter mit exotischem Charakter. Man kaufte sich keine blaue Weste, sondern ein „Gilet in bleu“, keinen rosa Schal, sondern einen „Shawl in rosé“. Meine Großmutter jedenfalls sprach Stoffe jeder Couleur stets so an. Der Klang erinnert nicht versehentlich an Vanitas und Fin de siècle. Man kann auch sagen: Snobwörter!
Zumeist werden solche Farbbegriffe unter kultivierten Manschen bis heute nicht flektiert und dürfen nur prädikativ auftauchen, also nach dem Verb, also so: „Georgs Hose ist beige.“ In attributiver Verwendung, das heißt meist vorm Substantiv, benutzt man dann Hilfsformen, etwa in dieser Art: „Die beigefarbene Weste besteht aus derbem Wollstoff.“ Ähnlich beim blassblauen Mineral, das „Uschis türkisfarbener Bluse“ sprachlich den sommerfrischen Touch verleiht. Dieser Farbton macht manchmal sogar – im vordringlichen Dasein als Substanz – Anstalten, als wolle er sich lieber in die Ersatzform mit der Endung „-farben“ hüllen und freiwillig attributiv sicher verpackt bleiben statt attributiv hinterherzuhüpfen, wie eine am Boden aufklonkende Pietra dura, die sich aus dem Ohrring gelöst hat.
Normalerweise wird die prädikative Verwendungsart solcher Farbwörter deshalb unbedingt bevorzugt, weil man attributive Eigenschaftswörter im deutschen Satz beugt oder steigert, und das will einem mit französischen Adjektiven einfach nicht gut gelingen. Es klingt jedenfalls nicht sehr vornehm, wie uns eben die ukrainischen Verhältnisse gelehrt haben. Wenn der Begriff lange genug mit Berliner Gaumen und Zunge bearbeitet wird, klappt auch das bei manchen Farbadjektiven. Das zeigt das Beispiel: „In Kreuzberg geriet ick jeden Tag in immer blümerantere Situationen.“ Ob aber bei dieser überraschend attributiven Positionierung die chromatische Qualität des „bleumourante“, also Mattblau, wirklich noch empfunden würde?
Nur ausgerechnet die zart rötelnden Einzelgänger Rosa und Lila sind so standfest, dass sie selbst attributiven Gebrauch aushalten, natürlich auch sie stets ungebeugt: „ein rosa Kleid“ (nicht „rosanes“), „eine lila Strumpfhose“ (nicht „lilane“). Aber Vorsicht! Das geht bei diesen beiden nur dann, wenn sie unbetont sind. Für Akzentuierungen sind sie allein dann doch zu schwach, dafür wappnen sie sich mit der Rüstung der Hilfsform: „Eine Unterhose, aber ja keine rosafarbene!“
Etwas leutseliger und robuster ist das kräftiger dem Rouge zusprechenden Violett, das attributiv daherkommen kann und dabei munter aus der Reihe tanzt, da ausgerechnet dieses eine, recht fremd klingende Farbwort ausnahmsweise doch flektiert wird („die beiden violetten Schärpen“), sich also nie die Hülle der Hilfsform umwirft.
Ganz anders wiederum am anderen Ende der Mutigkeitsskala die verzärtelten Geschwister Ocker und Oliv, die sich nur ungern allein ins Wortgetümmel begeben – am allerwenigsten wollen sie wie in einer Peepshow als nackte Einzelwesen vorn auf der Rampe des Satzbaus im Scheinwerferlicht des Attributiven stehen. Sie meiden sogar das Spazierstöckchen der üblichen Hilfsform, sondern brauchen die stabile Stütze befreundeter Couleurs so dringend wie die Neunzigjährigen ihren Rollator. So schmuggeln beide sich denn bevorzugt zusammengesetzt unter die Farbwörter, sei es attributiv, sei es prädikativ: „ein ockergelber Umhang“, „der Zylinder ist olivbraun“. Zum Sympathisanten haben sie bei der Mischerei das schon genannte Türkis, das uns als Zusammensetzung viele treffliche Möglichkeiten gibt, etwa zum Besserwissen, denn niemand kann einen widerlegen, wenn man ein hübsches Kleid nach gründlichem Hinschauen nicht für türkisblau hält, sondern eher für türkisgrün.
Noch exzentrischer sind koloröse Schöpfungen, die jede Saison einen neuen Namen bekommen, nach dem Motto: „Die Farbe war schon vor acht Jahren mal en vogue, da hieß sie aber noch anders.“ Solche inzwischen nicht mehr französischen, sondern englischsprachigen Wortkreationen vom Jahr 2021, etwa „Pirouette“, „Illuminating“ oder „Blue Atoll“, „Pickled Pepper“ und „Lava Falls“ lassen sich in ihrer Sperrigkeit fast gar nicht mehr in einen deutschen Satz einbauen, das überlassen wir besser den Reklamekatalogschreibern.
An diesem Punkt ist es aus mit dem, was uns die Farben auf Erden sind, nämlich nach Goethe die „Taten und Leiden des Lichts“, und auch mit dem, was die Farbe nach Ernst Strauss umgekehrt in der Malerei der Vormoderne war, nämlich die Schöpferin des Lichtes. Hier stehen wir vor einem mit dem Zufall spielenden Kalkül der Geschäftemacherei. Ein Treiben mit Tradition übrigens, denn zu Zeiten von Louis Seize waren die Pariser Couturiers schon genauso schöpferisch. Wie im Kaleidoskop aus immer denselben Krümeln stets neue allein dem Augenblick angehörende Kristallvisionen entstehen, so werden Koloraturdämpfe aus brodelnden Hexenkesseln für den flüchtigen Moment destilliert, die möglichst im Pantone-Fächer oder unter den RAL-Nummern noch nicht verzeichnet sind. Andere wollen mit demselben Zauberlöffel Dauerhaftigkeit und eherne Wiedererkennbarkeit züchten, denken Sie doch mal an die ach so schnell gestrig gewordene Purpurtünche des Telekom-Konzerns.
Glauben Sie aber nicht, die angeführten Glissaden auf dem blanken Parkett der Sprache wären bloß Zeichen teutonischer Plumpheit oder erst ein Dernier cri! Wie dichtete einst Carly Simon doch so schön über Mick Jagger? – Sie hat’s stets bestritten, aber das Ondit bleibt! Und er hat sogar mitgesungen! – „Your scarfit was apricot“ kündet ihr Alt, das klingt künstlich. Und es erklingt nur, um das überdrechselte Spiegeltänzeln in „You watched yourself gavotte“ seufzend zu einem möglichst exaltierten Reim nicht bloß zu paaren, sondern auch noch zusammen mit dem einleitenden „walking onto a yacht“ in eine Ménage à trois der Vanitas zu bringen. Yacht – gavotte – apricot, ja, das tönt alles nicht nur lautgleich, sondern wie dreifaches Naserümpfen! Womit wir wieder bei den Snobs wären. Wahrscheinlich gehört ja auch dieses mein Feuilleton über die Farben in der Sprache nur zum Rummel des Vanity Fair. Wie gern fällt Tout le Monde auf den Snobismus herein, Sie doch auch, oder? In Paris und Mailand ist jetzt Hochsaison auf dem Catwalk, von wegen Martinssingen!