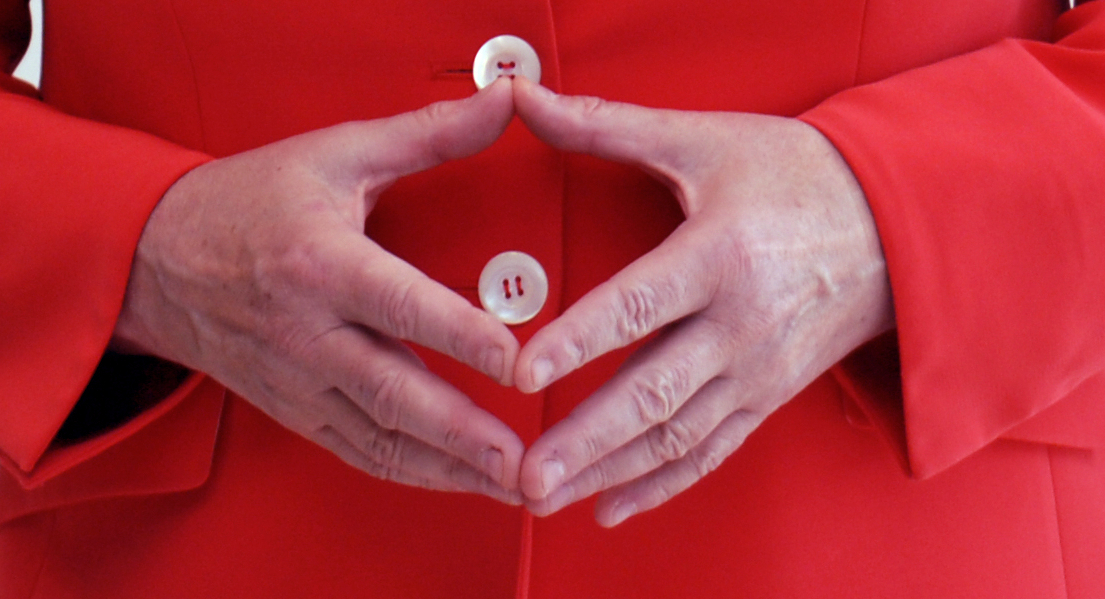Er war mal einer der Großen in der deutschen Politik, der seine Fans-und davon gab es viele- faszinierte, ja in seinen Bann zog. Wenn Oskar Lafontaine die politische Bühne betrat, jubelten ihm vor allem junge Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zu. Auch einer der Alten in der SPD, der große Willy Brandt, sah in ihm seinen eigentlichen Nachfolger. Ich habe damals Brandt beobachtet, wie er fast ein wenig stolz hoch zur Bühne schaute, auf der sein politischer Enkel, wenn man so will Erbe stand und redete und den Finger der rechten Hand in die Luft warf, um politische Ziele donnernd zu unterstreichen und den politischen Gegner kleinzureden. So war das einst. Der große Sozialdemokrat, dessen politische Laufbahn dort enden könnte, wo sie begann: an der Saar, im Landtag, allerdings als Chef der Linken-Fraktion, einer beinahe einflusslosen Partei, die fast den Einzug in den Bundestag verpasst hätte. Ein bisschen Krach muss dazu gehören, wenn er geht. Das muss wohl so sein bei einem wie ihm. Die Gründe spielen keine Rolle. Das Spiel des Oskar Lafontaine neigt sich dem Ende zu.
Aber blicken wir noch etwas zurück, um einen Teil des Weges nachzuzeichnen, den dieser Mann damals eingeschlagen hatte. In den 80er und 90er Jahren sprach man von den Enkeln der ältesten deutschen Partei und von d e m Enkel und das war Oskar. Im Sturm hatte er die Stadt Saarbrücken erobert, dann den Schwarzen das kleine Land an der französischen Grenze im Vorbeigehen weggenommen. In Bonn, der politischen Zentrale in jenen Jahren, war er der gefragte Mann, nach Helmut Kohl. Und wir, die Journalisten, fuhren quer durch die Eifel an Mosel und Saar, um Oskar Lafontaine zu erleben.
Arrogant und überheblich
Eigenwillig war er, auch ein Stück weit arrogant, überheblich, weil ihn auch die großen Medien, „Spiegel“, „Stern“, „Zeit“ und „Süddeutsche Zeitung“ als ihren Star feierten. Und er ließ es zu, den Blick gen Himmel gerichtet. Der Mann war von sich überzeugt und ließ seine Überlegenheit gelegentlich seine Umgebung und jene, die ihm in die Nähe kamen, spüren. Er war belesen, Künstler und Literaten suchten gern das Gespräch mit ihm. Dazu war er ein Genießer guten Essens und ausgesuchter Weine. In seiner Landesvertretung in Bonn leistete er sich einen 1-A-Koch und zog auch so die Aufmerksamkeit der Bonn-Besucher aus aller Welt auf sich und sein kleines, aber feines Saarland.
Als Kanzlerkandidat scheiterte er, vielleicht, weil er wegen des Attentats, das er gerade so überlebte, körperlich zu schwach war, vielleicht, weil er mit dem Thema deutsche Einheit nicht viel anzufangen wusste im Gegensatz zu Helmut Kohl, der sich als Kanzler der Einheit sah und feiern ließ. Lafontaine teilte nicht den Einheits-Jubel, für ihn war es kein Traum, der in Erfüllung ging. Er versuchte die Rechnung aufzumachen und er hatte Recht, auch wenn er sich in der Größenordnung irrte. Die wahren Kosten überstiegen alle Vorstellungen. Aber die Menschen im Osten wollten das nicht wissen, der Reiz der D-Mark war zu groß, zu verheißungsvoll all die Verlockungen, die der Westen ihnen damals zu bieten schien.
Als der starke Mann hinwarf
Aber Oskar Lafontaine kam wieder, stürzte mit Gerhard Schröder den blassen Rudolf Scharping auf dem Parteitag in Mannheim. Damals hatte die SPD in Umfragen gerade noch 23 Prozent der Stimmen. Quasi über Nacht wurde die Satzung der ehrwürigen Partei geändert, man könnte auch sagen, über den Haufen geworden, sehr zum Ärger des vor Wut rot im Gesicht angelaufenen Hans-Jochen Vogel. Lafontaine, der Zögerer und Zauderer, ergriff die Chance, wurde SPD-Chef und sorgte mit dafür, dass sich das Blatt wendete zugunsten von Gerhard Schröder. Das sollte man nie vergessen, wie der Parteichef die Front geschlossen hielt gegen alle Versuche von Kohl und den Seinen, die Sozialdemokraten in den Ländern mit finanziellen Zusagen auf ihre Seite zu ziehen. Nichts ging mehr. Schröder gewann zunächst die Landtagswahl in Niedersachsen mit so großer absoluter Mehrheit, dass Lafontaine seinen damaligen Mitstreiter noch vor Schluß der Wahllokale anrief und ihm mit den Worten gratulierte: „Hallo Kanzlerkandidat.“ Die Bundestagswahl gewann die SPD mit über 40 Prozent der Stimmen und bildete eine erste rot-grüne Koalition. Schröders grüner Partner im Kabinett hieß Joschka Fischer. Aber der starke Mann sollte eigentlich Oskar Lafontaine sein, der Bundesfinanzminister wurde und zugleich Parteichef der SPD blieb.
Kurz nach der Wahl begann die innere Zerreißprobe der SPD. Lafontaine musste erleben, dass er gegen den Kanzler nicht ankam. Er hätte praktisch eine Revolte vom Zaun brechen müssen, die aber Schröder als Regierungschef gefährdet hätte. Der Mann von der Saar fühlte sich mehr und mehr ausgetrickst vor allem von Kanzleramtsminister Bodo Hombach, dem Schröder-Vertrauten. Die erste Landtagswahl nach dem grandiosen Wahlerfolg ging im wichtigen Land Hessen verloren, weil die Sozialdemokraten allzu sehr mit sich selbst und ihren eigenen Problemen beschäftigt waren. So bekamen sie die Kampagne der hessischen CDU gegen den Doppel-Pass-Plan von Rot-Grün nicht mit (Wo kann ich gegen Ausländer unterschreiben?)
Es brodelte in der SPD. Und dann kam es zum Knall. Ein halbes Jahr nach der Wahl warf Oskar Lafontaine alles hin, den Parteivorsitz, er ließ das wichtigste Ministerium im Kabinett des Kanzlers, das Bundesfinanzministerium, hinter sich, kündigte dem Chef, gemeint Schröder, die Freundschaft auf,(wenn es denn eine war?!) verzichtete auf das Mandat im Bundestag und später verließ er die SPD, die er doch mitgeprägt hatte. Dann trat er nach, gegen Schröder, stänkerte gegen den Kanzler, die eigentlich von ihm gehasste Bild-Zeitung bot ihm die passende Kolumne dazu an. Und noch später gründete er zusammen mit Lothar Bisky die Linkspartei(gebildet aus der PDS-vorher SED- und einer Abspaltung der SPD, genannt WASG), die beiden genannten waren die Vorsitzenden.
Seine Zeit ist Geschichte
Und jetzt lese ich, dass der heute 78jährige Oskar Lafontaine, der mit Sahra Wagenknecht(52) verheiratet ist, bei der nächsten Landtagswahl im März 2022 nicht mehr kandidieren will. Der Fraktionschef der Linken im saarländischen Landtag hört auf. Man darf hinzufügen, der Mann hat schon wichtigere Ämter gehabt, das Saarland gehört eher zu den kleinsten Einheiten in der Republik und die Linke im Landtag ist entsprechend winzig. Sein Einfluss auf die Bundespolitik ist fast zu vernachlässigen.
Und dennoch: Mehr als 50 Jahre hat Oskar Lafontaine, wie er es selbst formuliert hat, der „res publica“ gedient, also dem Gemeinwohl. Aber seine große Zeit ist Geschichte, auch wenn es ein Abschied auf Raten ist. Nein, Mitleid, die Höchststrafe in der Politik, muss man mit ihm nicht haben. Das hat er nicht verdient.
Bildquelle: flickr, Dirk Vorderstraße, CC BY 2.0