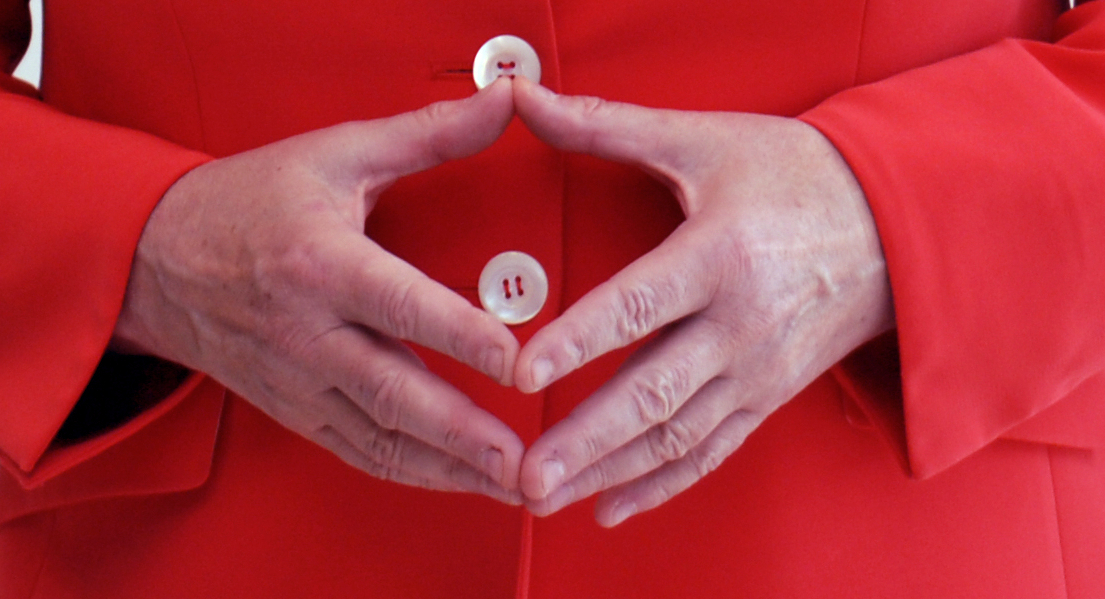Im Feld der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur kann man immer wieder Entdeckungen machen. So ging es mir mit Philipp Meyer (Jahrgang 1974), von dem ich gleich zwei seiner Romane hintereinander las: der eine trägt den Titel „Der erste Sohn“, der andere heißt „Rost“. Der eine bildet einhundert Jahre US-amerikanischer Geschichte im Kampf um Ressourcen und Revenuequellen ab; der andere den ökonomischen und sozialen Niedergang des sogenannten Rostgürtels, genau der Region im Nordwesten der USA, in der der Wahlkämpfer Donald Trump einst auf Wählerstimmenfang gegangen war, indem er der weißen, männlichen Industriearbeiterschaft neue Arbeitsplätze und so etwas wie blühende Landschaften versprach.
In beiden Romanen geht es um Verwerfungen im Kapitalismus, geschildert anhand der Lebensgeschichten konkreter Figuren, voller Lebendigkeit und Plastizität, faszinierend zu lesen, wenn auch oft brutal realistisch. Dieser Stil ist in beiden Romanen dem Gegenstand des Erzählens geschuldet. Bekanntlich ist die US-amerikanische Geschichte, angefangen mit der Sklaverei und der Ausrottung der indianischen Urbevölkerung, in Blut getränkt, und wenn ein Autor wie Meyer im Roman „Der erste Sohn“ (im Original erschienen 2013, in Deutsch 2014) auf diese Anfänge verweisen will, ebenso wie auf die Geschichte des akkumulierten Reichtums aufgrund von Landraub und Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft und Boden, dann geht das wohl nicht anders als in einem drastisch-realistischen Stil, der unter die Haut geht.
Einmal abgesehen von der Schilderung des grauenvollen Gemetzels, erfährt man auch viel über die verschiedenen indianischen Stämme, die nicht etwa friedlich zusammenstanden, um gegen die Landnahme der Weißen zu kämpfen; vielmehr waren sie untereinander verfeindet und bekämpften sich gegenseitig – eine Folge ihrer Unterdrückung und außerdem ein bekanntes Muster unter den Unterdrückten: die Unfähigkeit zur Solidarität. Ich lerne durch den Roman aber auch viel über indianische Kultur kennen: Die Indianer töten Tiere (Bisons u.a. Arten), um zu überleben und nicht, um sich zu bereichern. Sie verwerten nahezu alles an einem getöteten Tier: Die Innereien werden nicht nur gegessen, sondern die Innenhäute, Blasen, das Gedärm, alles wird zu nützlichen Gebrauchsgegenständen verarbeitet; das Fell wird geschabt, auf natürliche Weise gegerbt, bis es feinstes Leder geworden ist, welches zu Kleidungsstücken oder Taschen oder Scheiten weiterverarbeitet wird. Die Knochen werden getrocknet, gehärtet und dienen als Werkzeuge. Das Mark ist die edelste Delikatesse im Speiseplan, es ist nahrhaft wie geschmackvoll. Und so weiter. Dieser Kultur, die sich auch nach Stämmen kaum unterscheidet, liegt ein Kreislaufdenken zugrunde und schont die Ressourcen – also ein heute hochgehaltenes Prinzip der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung unter Natur- und Umweltschutzaspekten.
Die Bekämpfung, das Abschlachten der Indianer durch die Weißen und die Kasernierung der Überlebenden in sogenannten Reservaten hat zugleich ihre Kultur mit vernichtet. Das Marodieren ging, wie gesagt, auch auf die Indianer über, so dass „zum Schluss“ wirklich jeder gegen jeden gekämpft, gemordet, gemeuchelt hat, man übernahm Kampftechniken wechselseitig voneinander, wobei stets die Dominanz der Weißen vorherrschte; sie hatten sich die dafür notwendigen Ressourcen „angeeignet“, um noch mehr davon anzuhäufen, wie es in diesem Zitat auf den Punkt gebracht wird:
Die Amerikaner … er ließ seine Gedanken wandern. Sie dachten, nur weil sie etwas gestohlen hatten, sollte es niemand von ihnen stehlen dürfen. Aber das dachten natürlich alle: Egal, was sie genommen hatten, sie sollten es für immer behalten dürfen.
Er war nicht besser: Seine Verwandten hatten das Land den Indianern gestohlen, und doch dachte er nicht einen Moment daran – er dachte nur an die Texaner, die es seinen Leuten gestohlen hatten. Und die Indianer, von denen sein Volk es gestohlen hatte, hatten es wieder von anderen Indianern gestohlen.
Meyer hat hier einen ergreifenden Roman mit kulturgeschichtlichem Gehalt vorgelegt, in dem er mit wechselnden Erzählperspektiven verschiedene Zeitabschnitte anhand von biografischen Erlebnissen und Ereignissen einfängt und so das Persönliche mit dem Gesellschaftlichen verbindet. So liest man von Kapitel zu Kapitel Szenen aus verschiedenen Epochen und Perspektiven der Hauptfiguren – alles anhand der Ahnenfolge einer Familie, die sich verzweigt und auf unterschiedliche Weise im Daseinskampf steht.
Die titelgebende Romanfigur, der „erste Sohn“, ist als Junge und Vollwaise (seine Familie wurde von Indianern umgebracht) über sechs Jahre indianisch „sozialisiert“ worden, d.h. er war zwar ein Außenstehender, wurde aber zu verschiedenen Arbeiten herangezogen und insofern auch integriert in eine Gemeinschaft, die ihm zunächst fremd war, dann aber immer vertrauter; und vieles von dem, was er unter den Indianern in einer harten Schule lernte, wie etwa Jagd- und Kampftechniken, Lederherstellung und Kleidung anfertigen, beherrschte er sein Leben lang.
Beeindruckend in diesem Roman ist unter anderem die Geschichte von Jeannie, der Urenkelin des „ersten Sohnes“. Sie war schon als Kind „anders“, da sie sich als einziges Mädchen unter drei Brüdern von frühauf durchsetzen musste. Sie machte alles, was einem Mädchen „an sich“ verboten war, konnte mit den Kälbern und Rindern besser umgehen als ihre Brüder, wusste, wie man ein wildes Pferd einreitet und beschlägt etc. Und als Frau begnügte sie sich nicht mit der Rolle als Ehefrau und Mutter, sondern ging ins Ölgeschäft. Zuerst an der Seite ihres Mannes, nach dessen frühem Tod eigen- und selbständig. Wie schwer sie es hatte, bei gleicher Kompetenz Erfolg und Anerkennung in einem männlich dominierten Geschäftsfeld zu erlangen, davon zeugt das folgende Zitat:
Sie plante alles übertrieben penibel, trug für jede Entscheidung Material zusammen, nie las sie nicht, nie dachte sie nicht nach; es kam selten vor, dass sie ein Gespräch führte, ohne es zuvor im Kopf bereits geprobt zu haben, und manchmal redete sie sich ein, nicht einmal Hank {ihr Ehemann} hätte mit ihr Schritt halten können. Doch in nüchternen Momenten wusste sie, dass etwas fehlte. Die Männer in ihrem Umfeld waren sich immer sicher, dass sie recht hatten, auch wenn kein stichhaltiger Grund dafür vorlag. Darauf kam es an. Sich seiner Sache sicher sein. Wenn man Unrecht hatte, verteidigte man seine Position halt umso lauter.. Derweil wurde sie von allen bestohlen. … Man stellte ihr zweimal dieselbe Lieferung Mantelrohre und Bohrspülung in Rechnung. Sie wusste nicht, ob ihre Bohrmeister sie übers Ohr hauten oder die Lieferanten oder beide … Hanks Schwester verklagte sie, um die halbe Firma zu bekommen, und ihre eigenen Mitarbeiter hielten sie für dumm; sie folgten nur widerwillig Anweisungen, glaubten anscheinend, sie könne nicht zwischen guter Arbeit und schlechter Arbeit unterscheiden … Es gab Probleme bei der Verrohrung, Probleme bei der Zementierung, Probleme mit dem Zulauf, ständig ging die Ausrüstung kaputt … für Hank hatten sie ihr Bestes gegeben, für sie rührten sie keinen Finger.
Nach der Lektüre dieses Romans hat man einen tiefen Einblick in die Geschichte eines Landes, das auf Landraub, Unterdrückung und Ausmerzung der Ureinwohner, Menschenhandel und Sklaverei, Dominanz der Weißen als „Herrenrasse“ gegenüber den Schwarzen und anderen indigenen Völkern sowie bedingungslosem Geschäftsgebaren (ob in der Rinderzucht, im Viehhandel oder im Öl- und Gasgeschäft) basiert und gleichzeitig vom Mythos lebt, die Wiege der westlichen Kultur und der Menschenrechte zu sein. Die Verlogenheit dieses Mythos legt der Roman konkret anhand von persönlichen Geschichten als Gesellschaftsgeschichten bloß. Darin liegt, neben dem literarischen, sein kultureller und politischer Wert.
*
Im Roman „Rost“ (im Original erschienen 2009, in Deutsch 2012) erzählt Philipp Meyer die Geschichte einer Freundschaft zweier junger Männer, die auf eine harte Probe gestellt wird. Die beiden sind grundverschieden: der eine blitzintelligent und körperlich schmächtig; der andere bärenstark und von minderer Intelligenz, aber mit warmem Herzen; man könnte von komplementären Eigenschaften, Stärken und Schwächen sprechen, doch beiden geht der Wert ihrer Freundschaft über alles. Sie entstammen dem sogenannten Tal, einer Region im Nordwesten der USA, die einmal eine florierende Stahl- und Kohleindustrie-Metropole war, doch nun seit Jahren schon von Krisen geschüttelt und im ökonomischen und sozialen Niedergang begriffen; mit der Folge hoher Arbeitslosigkeit, grassierender Armut, verkommener Infrastruktur, sozialer Verwahrlosung und hoher Kriminalität. Man nennt diese Gegend daher den „Rostgürtel“, um den Verfall und das Morbide dieser Region zu bezeichnen.
Die beiden Freunde geraten beim Herumstromern zufällig in eine harte Schlägerei mit drei Obdachlosen; der Starke (Poe) wird beinahe lebensgefährlich verletzt, wenn ihn sein Kumpel (Isaac) nicht gerettet hätte, indem er den Aggressor unter den Obdachlosen tötet. Sie entkommen, hinterlassen am Tatort aber einen Rucksack als belastendes Beweismaterial. In puncto Lebensrettung sind sich die Freunde damit quitt; vorher schon hatte Poe einmal dafür gesorgt, dass Isaac in einer gefährlichen Situation mit dem Leben davonkommt.
Nach diesem Vorfall trennen sich ihre Wege: Isaac macht sich auf nach Kalifornien (zu Fuß und mit Güterzügen, auf die er unbemerkt aufspringt), nicht primär, um seiner möglichen Verhaftung zu entgehen; vielmehr zieht es ihn weg von seinem kranken Vater, den er betreut hatte, hin zur Universität, wo er, wie bereits zuvor seine Schwester, ein Studium absolvieren möchte. Poe, der zurückgeblieben war, wird als vermeintlicher Täter festgenommen – er verbüßt eine Haftstrafe für die Tat seines Freundes, den er nicht verrät. In dieser moralisch dilemmatischen Situation spielt der Polizist Harris, der für die Verhaftung Poes gesorgt hatte, eine starke Rolle: Um Poe aus dem Gefängnis zu holen und zu entlasten, bringt er die beiden anderen Obdachlosen um, so dass es keine Zeugen für das Verbrechen mehr geben kann.
Und es ist wiederum dieser Harris, der im Roman aus der Perspektive der Polizei, aber zugleich auch aus einer sozioökonomischen den Verfallsprozess des Tals wie folgt beurteilt:
Die Bevölkerung des Tals wuchs wieder, aber deren Einkommen sank weiter, alle Haushalte schrumpften, und seit Jahrzehnten war kein Geld mehr in die Infrastruktur investiert worden. Sie hatten Kleinstadtmittel für Großstadtprobleme. Nicht mehr lange, und alles würde kippen. Praktisch alle anderen Städte hier im Tal … waren schon drüber, und zwar unrettbar. Die letzte Woche war am hellichten Tag in Monessen einem ins Gesicht geschossen worden. So war’s überall, … und bei vielen von den jungen Leuten, wenn man sah, wie sie das akzeptieren, ihre nicht vorhandenen Aussichten, das war wie Funken in der Nacht, die dann erlöschen. Schon für einen Bürojob braucht man einen Uni-Abschluss, und es gab von diesen Jobs eh nicht genug. …
Harris hatte keine Ahnung, wie das ganze Land langfristig überleben sollte; für eine stabile Gesellschaft braucht es stabile Arbeitsplätze, fertig, aus. Diese Probleme konnte auch die Polizei nicht lösen. Bürger mit Altersversorgung und Krankenversicherung neigten nicht dazu, ihre Nachbarn auszurauben, ihre Frauen zu verprügeln oder Methamphetamin im Gartenschuppen aufzukochen. Aber trotzdem wollten alle gern den Cops die Schuld zuschieben – so als könnten Polizisten die Gesellschaft vorm Zusammenbruch bewahren. Ihr müsst aggressiver durchgreifen, sagten sie dann, so lange, bis man ihren Sohn beim Autoklau erwischte und ihm etwas grob den Arm verdrehte – dann war man das Ungeheuer. Das die Bürgerrechte vergewaltigte. Sie wollten schlichte Antworten, aber die gab es nicht. Sorgt halt dafür, dass eure Kids die Schule fertig machen. Betet, dass die medizinisch-technischen Fabriken sich hier niederlassen.
Der Schluss des Romans ist offen: Isaac kehrt auf halbem Wege um, die Freunde treffen sich wieder und fallen sich in wortloser Übereinstimmung um den Hals. Ein Roman voller starker Gefühle, der beispielhaft-realistische Biographien aus einer Region im Niedergang erzählt, die die Menschen mit herunterzieht. Zwar gibt es immer wieder Möglichkeiten, sich irgendwie über Wasser zu halten, und sei es zum Mindestlohn. Zu mehr haben sie es allerdings auch nicht bringen können. Hierzu meint Poe vergleichend: Früher herrschte Reichtum hier, nicht Reichtum, aber Wohlstand, viele, viele Stahlarbeiter, die pro Stunde dreißig Dollar kriegten, da war viel Geld unterwegs gewesen. Doch so würde es nie wieder sein. Der Absturz hatte lang gedauert. Heute zuckt keiner mit der Wimper, einen Mindestlohnjob anzunehmen.
Erstaunliche Parallelen zwischen US-amerikanischen und bundesdeutschen oder westeuropäischen Zuständen auf dem Arbeitsmarkt tun sich da auf: Entwertung der Bildungsabschlüsse, sinkendes Anspruchsniveau an Qualifikation und Einkommen unter den (ehemals) Beschäftigten, Mangel an Alternativen und Perspektiven. Aus heutiger Sicht ist nach Donald Trump auch sein Nachfolger Joe Biden darum bemüht, mit Milliardeninvestitionen dieser Wirtschaftsregion wieder auf die Beine zu helfen; ob diese Anstrengungen fruchten werden, ist noch nicht abzusehen.
Wer gerne packende Literatur dicht an den sozialen Verwerfungen des Westens liest und zudem einen Einblick in die US-amerikanischen Verhältnisse und ihre Geschichte erhalten möchte, der/dem seien die Romane von Philipp Meyer nahegelegt. Es lohnt sich, sie zu lesen.
Bildquelle: Pixabay, Bild von Iván Tamás, Pixabay License