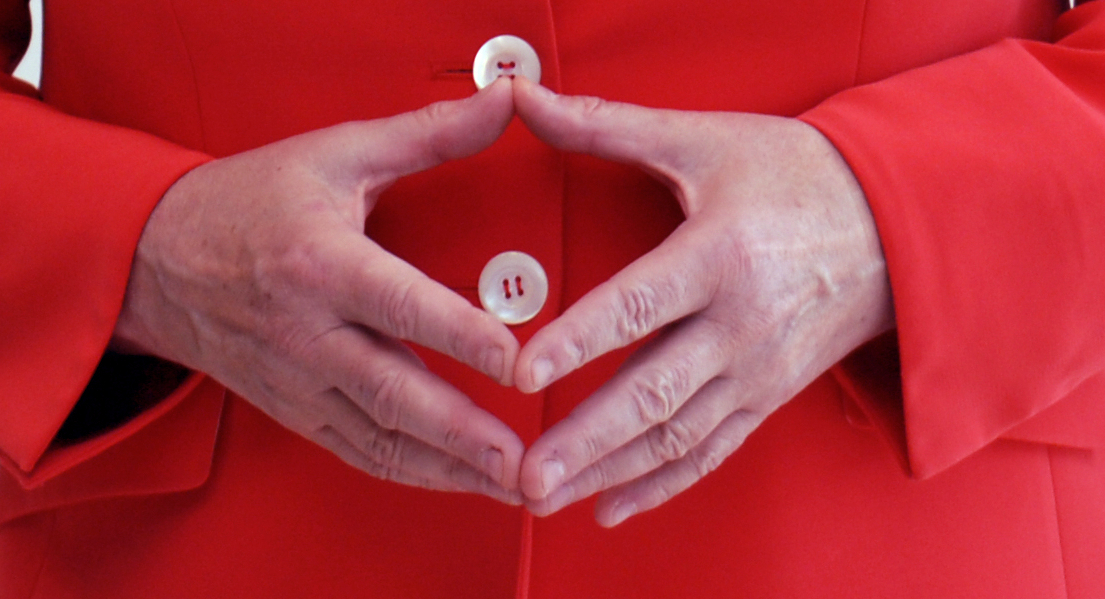Die Lektüre und Verarbeitung von Hans Mayers Studie über Deutsche Literatur 1945-1985 hat mich veranlasst, diesen Roman von Christa Wolf nach Jahren erneut zu lesen, zumal ich ihn im Rahmen des Essays über Christa Wolf mit Blick auf die Besonderheiten ihrer weiblichen Hauptfiguren unter dem Titel „Mater dolorosa“ nur unter anderem behandelt, also eher gestreift hatte.
Dieser Roman über die namensgleiche Christa T. fällt – um es salopp zu sagen – aus dem Rahmen: es ist die Erzähltechnik, changierend zwischen persönlicher Erinnerung und Reflexion über Nachforschungen der Autorin Wolf auf Basis von Briefen, Tagebüchern, Notizen von Christa T.; es ist auch ein Erzählen gegen die Chronologie einer Lebensgeschichte in ihrem dramatischen Ablauf; und es ist eine Art Vexierspiel zwischen Wirklichkeit und Fiktion, weil man nie sicher sein kann, ob diese Christa T. tatsächlich gelebt hat oder im wesentlichen eine Romanfigur ist, die viel mehr mit ihrer Schöpferin Christa Wolf zu tun hat, als es zunächst den Anschein haben mag.
Wie auch immer: geschildert wird eine Frau namens Christa T. mit all ihren unangepassten Bestrebungen, Wünschen, Hoffnungen, Ansprüchen an das Leben, die weder extravagant noch versponnen, sondern einfach unkonventionell ist, der Wirklichkeit (doch was ist das?, so wird gefragt) und Wahrheit (dito) verpflichtet, die auf der Suche ist, ein Leben lang, bis sie an dessen frühzeitigem Ende herausfindet, dass sie sich selbst als Ich sucht und dieses einzig und allein im Schreiben findet (davon zeugt besonders Kapitel 19). Dramatisch auch die Schilderung ihrer tödlichen Krankheit (Leukämie), ihres Sterbens und Todes, die Wolf in einer unnachahmlichen Weise zur Sprache bringt. Und schließlich erfährt man viel über die Bedeutung des Schreibens als Medium der Selbstfindung und -verwirklichung, sowohl für die eine wie die andere Christa.
Hier nun ausgewählte Stellen aus dem 19.Kapitel (S. 164ff.):
In den nachgelassenen Skizzen und Manuskripten heißt es etwa: Schreiben ist groß machen. Denn: Das Kleine und Kleinliche sorgt für sich selber. Der Sinn dieser Aussagen könnte sein, dass im Schreiben eine Art Vergrößerung stattfindet, die den vermeintlich kleinen Dingen im Leben ein Gewicht gibt, das ihnen im normalen Alltagsgeschehen nicht zukommt.
Immer wieder auch der eine Satz: Die große Hoffnung oder über die Schwierigkeit, „ich“ zu sagen.
Zum Geheimnis der dritten Person heißt es aus der Perspektive Christa Wolfs: SIE, die weiß, daß sie immer wieder neu zu sein, neu zu sehen hat, und die kann, was sie wollen muß. SIE, die nur die Gegenwart kennt und sich nicht das Recht nehmen läßt, nach ihren eigenen Gesetzen zu leben.
Hatte Christa T. also in der Distanz, die schreibend eher in der Er/Sie-Form als in der ersten Person zu erlangen ist, die Chance erkannt, sie zur Erweiterung der Spielräume des Lebens zu nutzen? Oder geht es um eine Identitätsproblematik, der auf dem Umweg der Sie-Form vielleicht beizukommen wäre? Oder um beides: sowohl als auch? Wolf weiter: Ich begreife das Geheimnis der dritten Person, die dabei ist, ohne greifbar zu sein, und die, wenn die Umstände ihr günstig sind, mehr Wirklichkeit auf sich ziehen kann als die erste: ich. Über die Schwierigkeit, ich zu sagen.
Über den Wert der Präzision des Ausdrucks beim Schreiben heißt es: Sie hatte Angst vor den ungenauen, unzutreffenden Wörtern. Sie wußte, daß sie Unheil anrichten, das schleichende Unheil des Vorbeilebens, das sie fast mehr fürchtete als die großen Katastrophen. Sie hielt das Leben für verletzbar durch Worte.
Man sieht: die Differenz zwischen Leben und Schreiben schwindet in solchen Formulierungen.
Das Diktum, man sollte sich beim Schreiben an die „Tatsachen“ halten, wird von Christa T. zugleich akzeptiert wie hinterfragt: Aber was sind Tatsachen? … Wie könnte denn alles, was passiert, für jeden Menschen zur Tatsache werden? Sie hat sich die Tatsachen herausgesucht, die zu ihr paßten – wie jeder, sagte sie still. Übrigens war sie süchtig nach Aufrichtigkeit.
So werden aus den von Wolf zusammengestellten Notizen Umrisse eines ästhetischen Konzepts über das Schreiben, und zwar nach Christa T.s ureigenen Vorstellungen von Realismus. Sie vertrat unser Recht auf Erfindungen, die kühn sein sollten, aber niemals fahrlässig.
Weil nicht Wirklichkeit wird, was man nicht vorher gedacht hat.
Sie hielt viel auf Wirklichkeit, darum liebte sie die Zeit der wirklichen Veränderungen. Sie liebte es, neue Sinne zu öffnen für den Sinn einer neuen Sache.
Und weiter heißt es in diesem Nachruf der Schriftstellerin auf die gerade sich entpuppende Schreibende:
Jetzt tritt sie hervor, gelassen gerade auch vor der Nichterfüllung, denn sie hatte die Kraft zu sagen: Noch nicht. Wie sie viele Leben mit sich führte, in ihrem Innern aufbewahrte, aufhob, so führte sie mehrere Zeiten mit sich, in denen sie, wie in der „wirklichen“, teilweise unerkannt lebte, und was in der einen unmöglich ist, gelingt in der anderen. Von ihren verschiedenen Zeiten aber sagte sie heiter: Unsere Zeit. … So birgt ihr tiefer und dauerhafter Wunsch für die geheime Existenz ihres Werkes: Dieser lange, nicht enden wollende Weg zu sich selbst. Welch ein Vermächtnis!Bis zum Schluss bleibt die gerade auch von Hans Mayer in seiner Deutschen Literaturgeschichte aufgeworfene Frage nach der Identität der Namensgleichen weiter offen; zumindest kann man die Behauptung wagen, dass in der Romanfigur, die vielleicht „wirklich“ gelebt hat und mit der Schriftstellerin Christa Wolf eng befreundet war, oder eben eine Fiktion ist, eine ganze Menge von Christa Wolf selbst steckt. Sie, die in späteren Werken immer wieder in große weibliche Rollen wie Kassandra oder Medea „geschlüpft“ ist, um mittels der (distanzierenden) Historisierung und der Fiktion eine sozialkritische Haltung einnehmen zu können, hatte vielleicht in Christa T. auch die Möglichkeit gesehen, auf diese Art geschützt Stellung zu beziehen, etwa in Sachen realistischen Schreibens, Auffassungen und Überzeugungen, die mit den offiziellen Vor- oder Maßgaben zum „sozialistischen Realismus“ durchaus in Nichtübereinstimmung standen. Wer weiß?
Bildquelle: Pixabay, Bild Devanath auf Pixabay License