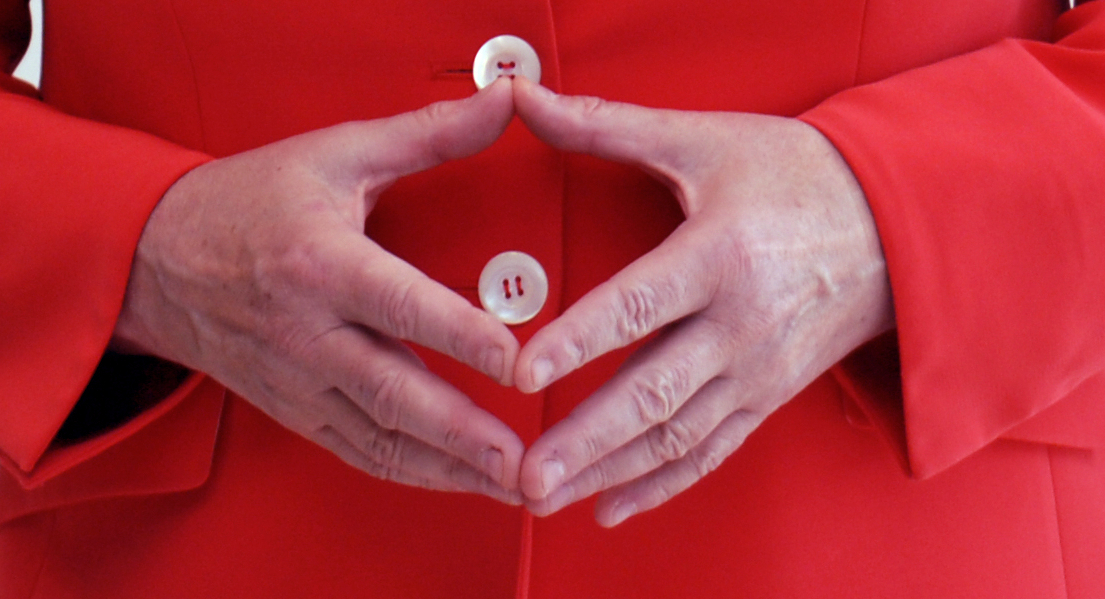Zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Japan haben die Vereinten Nationen nicht nur auf den friedensstiftenden Beitrag der sportlichen Wettkämpfe hingewiesen. Es stimmt ja auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr, dass für die Dauer der Spiele die Waffen schweigen. Zum aktuellen olympischen Geschehen hob die UNO eigens den weiblichen Charakter der Spiele hervor. Sie feierte es als Beleg für das zur Gleichstellung im internationalen Sport Erreichte, dass nahezu die Hälfte der Teilnehmer in diesem Jahr Frauen seien. Doch auch das ist nicht das vollständige Bild.
49 Prozent sind bemerkenswert, zumal Frauen bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 überhaupt nicht antreten durften. Zögerlich öffnete das Internationale Olympische Komitee (IOC) einzelne Sportarten wie Golf und Tennis, Bogenschießen und Eiskunstlauf für Frauen. Doch lange blieben die Athletinnen die Ausnahmen und trugen aus Protest in den 1920er Jahren eigene Olympische Frauenspiele aus.
Mit Blick auf die Aktiven sei heute das Etikett „geschlechterausgewogene Spiele“ durchaus verdient, sagt Dr. Petra Tzschoppe im Interview mit der Universität Leipzig. Dort lehrt die Sportsoziologin, die zugleich an Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist. Seit den Spielen 2012 sind in allen olympischen Sportarten auch Frauen am Start. Nun wurden zusätzliche Wettbewerbe und Mixed-Wettkämpfe eingerichtet, so dass sich die Anzahl der Teilnehmerinnen auf fast 50 Prozent erhöht hat.
Tzschoppe weist dennoch auf anhaltende Schieflagen hin. Da liege noch vieles im Argen, sagt sie, zum Beispiel beim Betreuungspersonal. „Bei den letzten vier Olympischen Spielen seit 2010 lag der Anteil der Trainerinnen jeweils bei zehn oder elf Prozent“, daran ändere auch Tokio noch nichts gravierend. „Im Speziellen stört mich, dass das deutsche Team keinen Beitrag leistet, dieses Missverhältnis zu verringern, wenn der Anteil akkreditierter Trainerinnen für Tokio gerade mal acht Prozent beträgt“, sagt sie. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang waren von den 80 Trainerinnen und Trainern des deutschen Teams sogar nur zwei weiblich. „Da bleibt also noch viel zu tun.“
Das gelte „in ähnlicher Weise für Kampf- und Schiedsrichterinnen. Auch ihr Anteil lag bei den vergangenen Spielen unter 30 Prozent“, bemängelt Tzschoppe, und sie meint, dass sich die deutliche Unterzahl an Sportjournalistinnen „in einer unausgewogenen Sportberichterstattung“ widerspiegele. „Und nicht zuletzt läuft noch nicht alles in zeitgemäßen Bahnen, wenn wir fragen, wo Frauen in den Führungspositionen im Sport sind.“
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) habe bis 1981 gebraucht, um „die erste Frau in dieses Gremium zu kooptieren“, erinnert Tzschoppe. „85 Jahre waren die Herren der Ringe unter sich geblieben.“ Allerdings habe es in den letzten Jahren erkennbare Bereitschaft und Aktivitäten für Veränderungen gegeben, so dass dem IOC mittlerweile 37,5 Prozent Frauen angehören. „Soweit sind viele Nationale Olympische Komitees noch nicht, und erst recht nicht die meisten Internationalen Sportverbände.“
Dort falle die Entscheidung über die Trainerinnen. Deren Anteil auf der Bundesebene sei „ohnehin schon sehr niedrig und wenn es um die Teilnahme an den Spielen geht, wird noch einmal selektiert“. Es gebe verschiedene Gründe für den generell so geringen Anteil von Trainerinnen und „die meisten haben mit überholten Rollenbildern zu tun“, meint die Sportsoziologin. „Das Argument etwa, dass dieser Beruf nicht familienfreundlich ist, betrifft ja alle. Auch Männer haben Familie und wollen zunehmend Zeit für ihre Kinder haben.“ Oft fange es schon damit an, dass Sportler bereits während ihrer Leistungssportkarriere von ihrem Verband angesprochen werden, ob sie nach ihrer aktiven Zeit als Trainer arbeiten möchten, Sportlerinnen hingegen nicht. Tzschoppe: „Das ist einfach nicht klug, denn so geht den Verbänden sehr viel Expertise und Kompetenz verloren.“
Sie würdigt das gesellschaftliche Signal, das von Geschlechterparität im Sport ausgehe: „Von Null Olympiateilnehmerinnen vor 125 Jahren in Athen auf fast 50 Prozent heute ist eine Botschaft, die zeigt, was auch auf anderen Feldern möglich ist. Mit ihrer starken weltweiten Ausstrahlung können sie so Impulse für Geschlechtergerechtigkeit nicht nur im Sport, sondern darüber hinaus in die gesamte Gesellschaft senden.“
Dazu gehöre auch, dass über die sportliche Leistung der Athletinnen in gleicher Weise berichtet wird, wie über die der Männer. „Das gilt für den Umfang der Berichterstattung, aber auch für den Inhalt. Hier geht es häufig um das Aussehen der Sportlerinnen, es dominieren herkömmliche weibliche Geschlechterklischees. Es sollte stattdessen um eine faire Darstellung und Wertschätzung ihrer sportlichen Leistungen gehen.“
Dazu passen die aktuellen Debatten über die Kleiderordnung im Frauensport. Boxerinnen dürfen nach langem Kampf mit Kopftuch in den Ring steigen, eine spezielle Badekappe für Dreadlocks wurde hingegen noch nicht genehmigt. Die deutschen Kunstturnerinnen haben bei der Europameisterschaft im April in Basel (Schweiz) mit Ganzkörperanzügen Aufsehen erregt. Sie wollten, sagte die Kölnerin Sarah Voss, ein Zeichen gegen Sexismus setzen.
Das gleiche Motiv hatten die Beachhandballerinnen aus Norwegen, die bei den Europameisterschaften in Varna (Bulgarien) statt der vorgeschriebenen Bikini-Hosen etwas längere Shorts trugen. Das ahndete die Europäische Handball-Föderation (EHF) prompt mit einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro – wegen „unangemessener Bekleidung“.
Tatsächlich schreibt der Weltverband im Regelwerk für Beachhandball das zulässige Outfit zentimetergenau vor: die Shorts der Männer müssen mindestens zehn Zentimeter oberhalb des Knies enden; die Hosen der Frauen dürfen an der Seite höchstens zehn Zentimeter breit sein. Eng anliegen müssen sie außerdem. Ganz wohl ist der EHF bei der Sache offenbar selber nicht. Sie betont, dass sie das Strafgeld für die Verletzung der Kleiderregel an eine internationale Sportstiftung spende, die sich um die Gleichstellung von Frauen und Mädchen im Sport bemühe.
Der Weg dahin scheint doch noch weiter zu sein, als die bloße Teilnehmerinnenzahl bei Olympia suggeriert. Solange mehr über die Kleidung als über die sportliche Leistung gesprochen wird, hat sich zum vorigen Jahrhundert nicht viel verändert. Die ersten Frauen, die bei den Olympischen Spielen auf den Tenniscourt wollten, mussten in bodenlangen Kleidern antreten – gemäß den von Männern gemachten Vorschriften.
Bildquelle: Pixabay, Bild von kalhh, Pixabay License