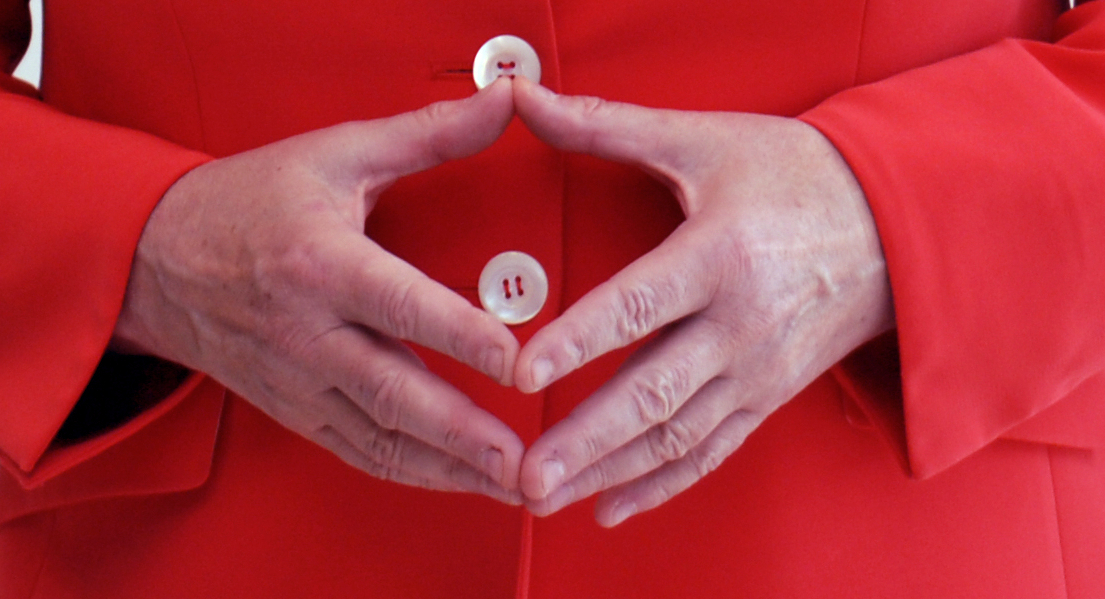Manche Bücher sind es wert, aus ihrem antiquarischen Status herausgeholt und neu gelesen zu werden. So auch die Studie von Hans Mayer von 1989, die als Taschenbuchausgabe 1998 im Siedler Verlag erschien.
Um sich dieser besonderen Literaturgeschichte zu nähern, ist der Klappentext eine hilfreiche Informationsquelle. Darin heißt es: „Als Kritiker und Germanist hat Hans Mayer wie kein zweiter die deutsche Literatur nach 1945 begleitet und geprägt. Seine beiden Bücher ‚Die umerzogene Literatur‘ und ‚Die unerwünschte Literatur‘ … sind mittlerweile zu Standardwerken geworden. Mayers Rückblick auf vierzig Jahre deutsche Literatur ist keine gewöhnliche Literaturgeschichte. Denn hinter Buchtiteln und Autorennamen stehen für ihn Menschen, Begegnungen und persönliche Erfahrungen. Er war Lehrer von Uwe Johnson und Christa Wolf, scharfzüngiger Wortführer der Gruppe 47, Freund von Heinrich Böll und Günter Grass. Brillant sind Mayers Interpretationen der Werke von Uwe Johnson, Peter Weiss oder Elias Canetti. Ebensosehr beeindrucken aber seine schonungslose Abrechnung mit der DDR oder seine scharfsinnigen Betrachtungen zur Studentenbewegung. Denn Mayer, der stets ein Suchender zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands gewesen ist, findet in der Literatur immer auch den Widerhall von Politik und Gesellschaft in beiden deutschen Staaten.“
Aufschlussreich sind zunächst Mayers Einschätzungen über die Emigration und die Emigranten; er selbst war als Jude beteiligt und spricht aus Erfahrung (er emigrierte 1933 nach Frankreich und weiter in die Schweiz), und dies vor dem Hintergrund seiner hohen sozialen und soziologischen Kompetenz. Mit der Emigrantenliteratur geht Mayer äußerst kritisch um; er bescheinigt ihr eine Unfähigkeit, die Sachverhalte der „neuen Heimatlosigkeit“ so zu erzählen, dass sich aus unterschiedlichen Erfahrungen dennoch ein gemeinsamer Erlebniszusammenhang herauskristallisiert. Den Grund dafür sieht er im Kern darin, „daß der Begriff Exil selbst nichts war als eine Fiktion“. Das heißt, obwohl es „gemeinsame Schwierigkeiten mit Paß und Visum, Auswanderung und Einwanderung“ gab, existierte kein Zusammenhalt, kein Verständnis füreinander und keine Verständigung unter den Emigranten, das sie Trennende war dominant; „nirgendwo stärker als vor der Tatsache des Exils offenbarte sich die gesellschaftliche Ungleichheit“. Diese Ungleichheit bezog sich auf die ökonomische Grundausstattung der Einzelnen und der damit verbundenen Privilegien wie auf die differente Motivation zur Emigration. „Man bildete keine ‚verschworene Gemeinschaft‘ im Exil. Gegensätze der politischen und unpolitischen Emigration; die jüdischen und nichtjüdischen Flüchtlinge. Fortdauer der ideologischen Gegensätze.“ An dieser Stelle verweist Mayer auf eine Szene aus „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ von Bertolt Brecht, in der dieser schildert, „wie alle Auseinandersetzungen der Epoche vor 1933 noch im Konzentrationslager fortdauerten“. Ähnlich ging es in den Emigrantenkreisen zu. „Alle Volksfront- und Schriftstellerkongresse der Emigration täuschten darüber nicht hinweg.“ Zu den bezeichneten Differenzen von sozialer Ungleichheit und Motivation offenbarten sich denn auch auf dem 1. Schriftsteller-Kongreß 1947 zusätzliche, die sich in der Konfrontation und im Unverständnis zwischen Ost und West sowie zwischen Emigraten und Vertretern der Inneren Emigration ausdrückten.
So radikal und schonungslos kann das nur einer wie Hans Mayer beurteilen, der selbst über entsprechende Erfahrungen und Hintergründe verfügt. Und er nutzt diese, um mit Mythen und Legenden über das Exil und die Emigranten aufzuräumen.
***
Herausragend auch Mayers Kafka-Interpretation, von dem er sagt, sein Werk sei „letztlich nicht interpretierbar“, zumindest nicht nach gängigen Methoden wie etwa die theologische oder die existentialistische Auslegung. Auch mit einem Gegensatzschema von Verfremdung und Einfühlung, von dem Brecht in seiner dialektischen Dramaturgie ausgeht, werde man der Erzählkunst Kafkas nicht gerecht. „Kafka gibt Zustände und betreibt eine Art der erzählerischen Verhaltensforschung. … Kafka hat keinerlei Sympathie für die verschiedenen K’s oder Samsas. Er denkt mit ihnen, wie man vielleicht einen Schritt weiterkommen könnte und beschreibt diese Überlegungen. Niemals jedoch erfährt man …, wie der Erzähler die Ereignisse und Personen beurteilt, mit denen seine Gestalten sich herumschlagen. Wo die Romanfigur einen Zustand der Korruption zu entdecken glaubt, läßt uns Kafka gänzlich ohne Antwort, wenn wir ihn fragen, was er dazu sagt. / Er versteht seine Figuren, fühlt sich aber nicht in sie ein. Als Erzähler beschreibt er Gedankengänge und Taten, allein er hütet sich, durch Psychologie nachhelfen zu wollen. Das macht: er glaubt nicht mehr an die alten Kausalitäten. Seine Figuren verändern sich nicht, erleben keinerlei klassische Wandlung, weder Schuld noch Sühne, sind weder verstehbar noch unverstehbar. Sie verhalten sich bloß. Kafka beschreibt ihr Verhalten in doppelter Weise: als Reflexion und als Aktion.“
Mayer, der auch immer rezeptionsgeschichtlich argumentiert, erklärt die Tatsache, dass Kafka in der Nachkriegszeit zu den meistgelesenen Schriftstellern zählte, damit, dass seine Erzählweise einen „parabolischen Charakter“ aufweise, also gleichnishaft ausgerichtet sei, was unter anderem Brecht begierig aufgegriffen habe.
Mit der Zuspitzung seiner Interpretation auf das „bloße Verhalten“ der Figuren Kafkas legt Mayer eine Gedankenschärfe an den Tag, die dem Werk und Autor wahrscheinlich äußerst gerecht wird; gleichwohl ist auch sie nicht leicht zu verstehen und bedarf weiteren Kafka-Lesens und Nachdenkens.
***
Im Kapitel über Wolfgang Koeppen und Heinrich Böll stellt Mayer zwei zentrale Repräsentanten der westdeutschen Nachkriegsliteratur vor. Doch während sie seit Mitte der fünfziger Jahre „wie ein Doppeldenkmal einer neuen, vielleicht nicht besonders umerzogenen Literatur“ präsentiert wurden, vergleichbar mit Paarungen wie Schiller und Goethe, Keller und Meyer, Musil und Broch, stellt Hans Mayer über das Gemeinsame hinaus in seiner Argumentation vor allem auf die Differenzen zwischen diesen beiden Autoren ab: „Die Gemeinsamkeit … besteht nur als Gleichzeitigkeit ihres Hervortretens und ihrer Lebenszäsur, die sie, gleich vielen Zeitgenossen, literarischen und anderen, als Narben tragen müssen. Im Übrigen ist kaum ein größerer Gegensatz denkbar. Böll ist ein Erzähler, der seinen Zorn hinausschreien muß; Koeppen frißt die Erbitterung in sich hinein. Böll betrachtet sich weitgehend als Zurechnungspunkt für Erlebnisse; wichtig an ihnen scheint ihm vor allem, daß sie nicht nur ihm selbst zustießen, sondern auch anderen seinesgleichen. Wolfgang Koeppen sieht sein eigenes Erleben nicht als stellvertretendes Erleiden, sondern als ein – höchst persönliches – Geschlagensein. Böll versucht immer wieder, das subjektive Geschehen, welches ihm zustieß, zu objektivieren. Er ist vor allem ein bewußter Zeitgenosse. Koeppen bemüht sich immer wieder, das Geschehen, das seiner Generation zustieß, … zu subjektivieren: wichtig ist vor allem die Form, in welcher es ihm selbst und an ihm selbst geschah. Er möchte ein bewußter Außenseiter bleiben.“
Wolfgang Koeppen, der vor allem durch seine „Trilogie des deutschen Alltags“ („Tauben im Gras“ , „Das Treibhaus“ und „Tod in Rom“, zwischen 1951 und 1954 erschienen) bekannt wurde, repräsentiert für Mayer die „literarischen Widersacher“ zur von ihm so bezeichneten „fröhlichen Restauration“ der unmittelbaren Nachkriegszeit.[1] Als Beleg zitiert er Passagen aus Koeppens Darmstädter Dankrede anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises von 1962, kulminierend in der Aussage: „Der Schriftsteller ist kein Parteigänger, und er freut sich nicht mit den Siegern.“
Das zielte auch auf Gottfried Benn, mit dem sich Koeppen immer wieder kritisch auseinandersetzte.
Es war eine Rede über sein Selbstverständnis und die Verantwortung als Schriftsteller, in der Koeppen aus heutiger Sicht auch eine enorme Weitsicht bezüglich der technischen Entwicklung und des medialen Einflusses auf das Bewussstsein der Massen durchblicken lässt: „Ich versuchte, Ihnen vom Schriftsteller als Einsamen, als Beobachter, als Außenseiter, als dem Mann allein an seinem Schreibtisch zu sprechen. Aber ich meine nicht den armen Poeten in seiner Dachkammer, den Künstler als Spitzweg-Erscheinung. Der Schreibende, so sehr er Mikrophon und Kamera und Scheinwerfer scheuen mag, wird sich dem neuen heraufziehenden Analphabetentum von Bildzeitungen, Comicstrips, Fernsehen und auf höherer Ebene von technischen Formeln, die uns manipulieren, automatisieren, vielleicht zum Mond führen, stellen müssen.“
Solche Aussagen zeugen von einer skeptischen Weltsicht wie von einer politisch basierten Verantwortungshaltung als Schriftsteller, die in der Tat weder „fröhlich“ noch „restaurativ“ ist, wohl aber hoch sensibel für Gefahren und Fehlentwicklungen, denen sich der Schreibende zu stellen hat. Dass Hans Mayer eine tiefe Sympathie für Wolfgang Koeppen hegt, daraus macht er kein Hehl. Obwohl mit Heinrich Böll befreundet, steht er offenkundig, wenn es um den Gegensatz beider Autoren geht, auf der Seite des „Außenseiters“. Nicht zuletzt belegt auch der Exkurs über das „Reisen mit Koeppen“, in welchem Mayer diese ungewöhnlichen wie originellen Reisebücher vorstellt, (in denen der Autor sich in historische Figuren verkleidet, um mit ihnen in die Vergangenheit zu reisen) diese Affinität.
***
Über die Gruppe 47 ist viel geschrieben worden, und natürlich widmet sich Hans Mayer dieser in Ausführlichkeit, was besonders aufschlussreich ist, da er als Beteiligter und Mitglied mit Innenansichten aufwarten kann. So berichtet er über Auseinandersetzungen und Konflikte ebenso wie über die herausragenden Leistungen Einzelner wie des Kreises insgesamt, auch im Sinne des Zusammenhalts. Dass die Gruppe so lange existierte (von 1947 bis 1967), ist nach Mayers Einschätzung (die von vielen Mitgliedern und Externen geteilt wird) vor allem das Verdienst des langjährigen „Chefs“ Hans Werner Richter. Über die Gruppe und ihn schreibt er: „Die Gruppe 47 … hat stets das Gegenteil sein wollen einer literarischen Schule mit Doktrin und allgemein anerkannter Arbeitsweise. Noblesse und freundschaftliche Toleranz des Chefs hätten da nichts bewirken können im Sinne irgendeiner Programmatik. Glücklicherweise war Hans Werner Richter das Gegenteil eines Fundamentalisten. Er besaß Autorität; folglich brauchte er sie nicht zu postulieren. Der bisweilen hämisch gemachte Einwand, Richters Autorität habe darauf beruht, daß er literarisch nicht recht mithalten konnte, ist ebenso ungerecht wie töricht. Sein Urteil zählte, auf sein Urteilsvermögen war Verlaß. Die wirklich bedeutenden Literaten des Kreises wußten genau, daß die scheinbare Naivität des Chefs ein Rollenspiel meinte, das man zu respektieren hatte. Wehe dem, der darauf hereinfiel.“
Und in einer Art Resümee über den auch politischen Stellenwert der Gruppe 47 vermerkt Mayer: „Es war gemeinsamer Widerstand gegen die Fröhliche Restauration der Fünfziger Jahre. Und es war Freundschaft.“
***
Im Kontext von Mayers Abhandlung über die Schriftsteller*innen der DDR, die sich in den ersten Nachkriegsjahren hervortaten, sei hier zunächst auf die Bedeutung der Literaturzeitschrift „Sinn und Form“ hingewiesen, die diesen ein hochklassiges Forum bot. Mayer schreibt: „Zu Beginn des Jahres 1949 erkämpfte sich Johannes R. Becher eine eigene Literaturzeitschrift. Er nannte sie ‚Sinn und Form‘ und wollte damit bewußt an Thomas Manns Exilzeitschrift ‚Maß und Wert‘ anknüpfen. Chefredakteur des Herausgebers Becher wurde Peter Huchel. Er hat die Zeitschrift … bis Ende 1962 geleitet. Dann nahm man sie ihm weg. Wer die Jahrgänge heute anschaut, begehrte Raritäten, wird feststellen, daß hier, unter scheinbar hemmenden Arbeitsbedingungen, die bedeutendste deutsche Literaturzeitschrift der Nachkriegszeit entstanden war. Peter Huchel veröffentlichte selbstverständlich die wichtigsten Autoren des Ostblocks und der später sogenannten Dritten Welt, doch nicht einen einzigen Text der einfältigen Agitationsliteratur. Aber Walter Benjamin wurde da zum ersten Mal in Deutschland wieder gedruckt oder Adorno und Bloch und der Österreicher Ernst Fischer und die russischen ‚Formalisten‘ der Zwanziger Jahre.“
Hans Mayer versteht es, mit großem Sachverstand und Feingefühl die literarischen Spitzenleistungen einzelner Autor*innen der DDR, allen voran Uwe Johnson, Christa Wolf, Bruno Apitz, Anna Seghers, Heiner Müller, durch seine klugen Interpretationen herauszustellen, so dass sie denen der westdeutschen gleichwertig und ebenbürtig zur Darstellung kommen. Nicht zuletzt wird deren Verdienst vor dem Hintergrund von „Systemzwängen“ in Form von Versuchen der Gängelungen und Bevormundung, politisch-bürokratischer Einflussnahme, Leitbildern und Normierungen („sozialistischer Realismus“), Privilegierungen und Benachteiligungen als besonderes Erschwernis gewürdigt, jedoch stets anhand literarischer und literaturkritischer Maßstäbe und Beurteilungen. Diese Abhandlung bildet dann die Grundlage dafür, dass Mayer im Fortgang seiner Studie eine „Grenzüberschreitung“ vornehmen kann, indem er nicht länger nach Ost und West scheidet, sondern nach thematisch-inhaltlichen Aspekten die Schriftsteller*innen und ihre Werke zusammenführen und abhandeln kann.
Der erste Band schließt ab mit einer Zäsur, die sich Mitte der Sechziger Jahre herauskristallisiert: Das Ende der „fröhlichen Restauration“.
„Der Umschlag vom entfremdeten kleinbürgerlichen Alltag zur jähen Anklage eines politischen Mitläufertums erfolgt erst um 1965. Zwanzig Jahre nach Kriegsende. Nun stellen die nachwachsenden, nur scheinbar umerzogenen Schriftsteller, angesichts einer fröhlichen Restauration die Frage nach der Schuld der Schuldlosen.“ Belegt wird dieser „Umschlag“ mit Werken etwa von Siegfried Lenz und seinem Stück „Zeit der Schuldlosen – Zeit der Schuldigen“ oder denen von Nossack, Eich, Koeppen, Böll, Walser, Frisch, Hochhuth, Dürrenmatt, Kluge, Johnson, Seghers, Apitz u.a.m. Sie alle eint der Zweifel an der Schuldlosigkeit der Mitläufer bzw. die Frage nach den (Mit-)Schuldigen an den Verbrechen des NS-Regimes und die Anklage mit literarischen Mitteln, der ein hoher Aufmerksamkeits- und Aufklärungswert zugekommen ist. „Gestellt war die Frage nach der Schuld der Nichttäter.“
***
So bedeutet denn auch die Studentenbewegung und das Jahr 1968 für Hans Mayer eine Zeitenwende, die er – wie eher selten in seiner Generation – gebührend würdigt. Für ihn sind Rudi Dutschke oder Wolf Biermann Repräsentanten eines frischen Windes, der dem „Muff unter den Talaren“ entgegenbläst und dem „System Springer“ Paroli bietet. Dutschkes tragischer Tod als Folge des Attentats auf ihn berührt Mayer merklich, denn er war ihm eine Art Symbol- oder Leitfigur dieser Zeitenwende.
Literarisch sieht er in Hubert Fichte mit seinem Roman „Die Palette“ und Christa Wolf mit „Nachdenken über Christa T.“ beispielhafte Werke, die er mit dem Jahr 1968 verbindet. Ihnen widmet er sich jeweils mit eingehenden Werkinterpretationen. So heißt es über Fichtes Werk: „Das literarisch Besondere … dieses Buches aus dem Jahr 1968 liegt darin, daß ein durchaus neuer, ungewohnter Themenkreis nunmehr Einzug hält ins wohlbehütete und auch von den Autoren der Gruppe 47 bisher im wesentlichen respektierte Haus der Schönen Literatur.“ Themen wie Langeweile und Entfremdung sind es, auf die Mayer eingeht und die literarischen Vorbilder wie Proust oder Genet herbeizitiert. In Fichtes Roman heißt es etwa: „Nun hat sich eine seiner Sehnsüchte in die Palette gebohrt. Das Gefühl der Langeweile. Die Sehnsucht. Die Enttäuschung. Die Langeweile. Und es langweilt Jäcki, wieder aufzubrechen, wie er sonst aus den Langeweilen aufbrach.“ Und Mayer kommentiert: „Alles ist für den Erzähler wohlbekannt, alles bleibt fremd, fast undurchdringbar. In all seinen Büchern hat Fichte auf irgendwelche Bewertungen genauso verzichtet wie auf das Ich. Stets bleibt er distanziert, auch zu Jacki. Warum Jäcki, abgesehen von der Langeweile, in die ‚Palette‘ gehen will, immer wieder, wird nicht erläutert. Wozu auch?“
Das Außenseitertum seiner Hauptfigur Jacki und die Abwesenheit des Ichs in Fichtes Roman bildet für Mayer eine thematische Brücke zu „Christa T.“: beide Werke sind ihm Zeugnisse einer Identitätsproblematik und als Resultat eines langen Prozesses der Selbstvergewisserung und -findung zu verstehen. Und obwohl sie anscheinend mit der „Austreibung und Revolte“ dieser Zeit nichts zu tun haben, ist das gemeinsame Erscheinungsjahr 1968 mehr als ein Zufall.
Auch Christa Wolf wartet mit einer Romanheldin auf, die die DDR-Literatur bisher nicht gekannt hat. Geschildert wird das biografische Geschehen einer „Unzeitgemäßen“ als „Lebensvorgang“ und gleichzeitig als „Kunstvorgang“. „Diejenige Gestalt des Buches, die nachdenkt über Christa T. nach deren Tode, kramt in Erinnerungen, wühlt in Briefen, um das erinnerte Leben der Freundin aus der verlorenen Zeit in die wiedergefundene Zeit zu verwandeln.“ Hans Mayer geht dem Geheimnis der Identität zwischen der Romanautorin und der Kunstfigur gleichen Vornamens akribisch nach, um auf die „bewußte Konturlosigkeit“ beider aufmerksam zu machen. Die (Vor-)Namensgleichheit sowie die Tatsache, dass beide dazu noch Germanistinnen und Schriftstellerinnen sind,
gipfelt in der Vermutung, es handele sich auch bei Christa T. um die Autorin selbst. „Aber es geht noch weiter. Nicht nur die Lebenskonturen der Christa T. präsentieren sich in kunstvoller Undeutlichkeit; stärker noch verschwinden die Grenzlinien zwischen derjenigen, die nachdenkt über Christa T. –, und dem Objekt ihres nachdenkenden Erinnerns.“ Die Lösung für dieses Verwirrspiel, das Christa Wolf betreibt, findet Mayer darin, dass es sich – egal, wer nun wer ist – um einen besonderen Emanzipationsprozess der Identitätsfindung handelt. „Die Schriftstellergestalten bei Christa Wolf, sowohl das Subjekt wie das Objekt des Erzählens, behandeln den Vorgang einer Befreiung durch Schreiben. Christa Wolf faßt diesen Prozeß, der die geheime These des Buches darstellen dürfte, in das Wort von der Schwierigkeit, ‚ich‘ zu sagen.“
Und diese Schwierigkeit beim Ich-Sagen, zu der die Charakterisierung als „Unzeitgemäße“ ebenso passt wie die Erfahrung, dass es „keine Lücke“ für sie gäbe im Leben (man denke nur an Christa Wolfs Roman „Kein Ort, nirgends“) wird nicht nur von beiden Christas geteilt, sie eint vor allem die erfahrene Gewissheit, dass dieser Lernprozess nur über das Schreiben realisierbar ist.
***
Es ist im Rahmen dieser Sekundäranalyse der Studie von Hans Mayer nicht möglich, auf alle Perlen, die sie aufweist, näher einzugehen. Ich kann vor dem Hintergrund meiner bisherigen Ausführungen nur empfehlen, sich mit dem Original zu befassen. Wer – wie ich – beispielsweise von der Schwierigkeit weiß, Uwe Johnsons „Jahrestage“ oder Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“ oder Peter Weiss‘ „Ästhetik des Widerstands“ lesend und verstehend sich anzueignen, dem seien die umfänglichen wie aufschlussreichen Interpretationen Mayers nahegelegt. Wer wissen möchte, dass und wie beispielsweise Johnson auf Proust, Joyce und Musil zurückgreift, wird hier fündig. Anregend und frisch kam mir der Hinweis daher, dass seine „Jahrestage“ und Musils großer Roman auch als „Gegenentwürfe“ zu Thomas Manns „Zauberberg“ zu lesen seien. Oder dass die „Dialektik von Melancholie und Utopie“, Satire und „unglücklichem Bewusstsein“ eine Brücke schlägt zwischen augenscheinlich so disparaten Werken und Autoren wie Günter Grass, Thomas Bernhard und Heiner Müller u.a.m. So etwas ist schon erhellend und kann die eigene Lesart von Literatur befruchten, ohne dass man sich mit einer Art Vorgabe von Interpretationsmöglichkeiten beeinflusst vorkäme. Es sind die Anregungen eines Kenners, auf dessen Urteil Verlass ist.
[1] Mit diesem Begriff bezeichnet Mayer eine restaurative Kulturpolitik in der Adenauerzeit, die von christlich-kleinbürgerlichen Moralvorstellungen geprägt war und nach „gut christlicher Hausvaterart“ das Fühlen und Denken der Menschen zu bevormunden trachtete; Thomas Mann sprach vom Unwesen der „kulturellen Saubermänner und Sauberfrauen“.
Bildquelle: Pixabay, Bild von Comfreak, Pixabay License