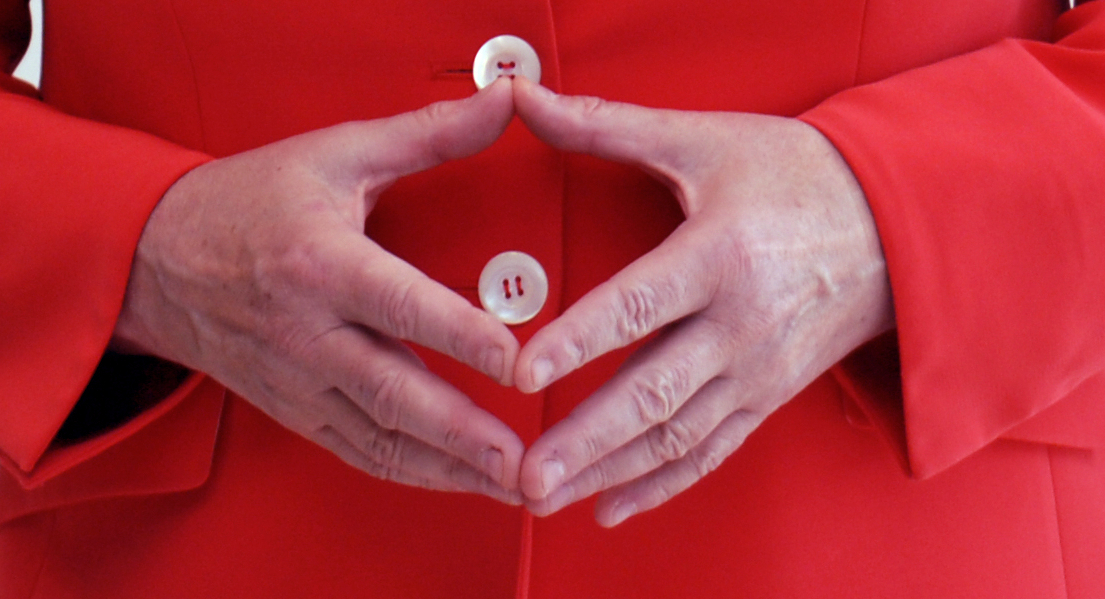In seinem Buch Ein Kind beschreibt Thomas Bernhard in permanenten Zeitsprüngen seine unglückliche Kindheit. Seinen Vater lernte er nie kennen, und mit seiner Mutter verband ihn zeitlebens eine Art Hassliebe.
Der Großvater ist es, bei dem er Trost findet, der an ihn glaubt. Der Großvater ist es auch, dem er sein Wissen verdankt. Er nimmt ihn auf seinen Spaziergängen mit, erklärt ihm die Natur und die Dinge des Lebens. Von ihm sagt der Autor: Die Großväter sind die Lehrer, die eigentlichen Philosophen jedes Menschen, sie reißen immer den Vorhang auf, den die andern fortwährend zuziehen.
Die Beiden sind unzertrennlich. Wir erfanden uns eine Welt, die mit der Welt, die uns umgab, nichts zu tun hatte. Der Großvater schützt ihn vor den destruktiven Einflüssen der Umwelt; vor allem der Schule und der eigenen Mutter, die ihn mit ihren ständigen Vorwürfen traktiert, er sei nur Ballast für sie, zu nichts zu gebrauchen und werde es auch zu nichts bringen,
Schlüsselstellen des Textes sind eine gescheiterte Fahrradtour des Achtjährigen nach Salzburg – eine Art Fluchtversuch von zu Hause weg. Der Versuch missglückt zwar, macht ihn aber dennoch stolz auf sich, weil er ihn gewagt hat und ziemlich weit gekommen ist. Darin zeigt sich, wie sich eine Art Widerständigkeit im Knaben entwickelt, der verzweifelt versucht, nicht gänzlich unterzugehen oder sich gar umzubringen.
Dann ist da die Verschickung in ein sog. Kindererholungsheim ins ferne Saalfeld in Thüringen. Ihm war seitens der Mutter vorgegaukelt worden, es diene seiner Erholung; in Wirklichkeit entpuppte sich das Heim als Anstalt für schwer erziehbare Kinder; mit allen Attributen einer autoritären, nazistisch geprägten Erziehung. Er fühlte sich abgeschoben und musste mehrere Monate in dem Heim verbringen. Eine Erfahrungen, die ihn für das ganze Leben prägte.
Und immer wieder schildert er die Qualen des Schulbesuchs; eine einzige Tortour für den unehelichen Sohn einer armen Familie, für den die Schule ein Ort der permanenten Demütigung ist. Ich war dem Spott meiner Mitschüler vollkommen ausgeliefert. Die Bürgersöhne in ihren teuren Kleidern straften mich, ohne dass ich wusste, wofür, mit Verachtung. Die Lehrer halfen mir nicht, im Gegenteil, sie nahmen mich gleich zum Anlaß für ihre Wutausbrüche. Ich war so hilflos, wie ich niemals vorher gewesen war. Zitternd ging ich in die Schule hinein, weinend trat ich wieder hinaus. Ich ging, wenn ich in die Schule ging, zum Schafott, und meine endgültige Enthauptung wurde nur immer hinausgezogen, was ein qualvoller Zustand war.
Während der Schulstoff ihn unendlich langweilt, tröstet ihn sein Großvater damit, es komme nur darauf an, durchzukommen, wie, das sei vollkommen gleichgültig, er halte nichts von Noten. Ich sei überdurchschnittlich intelligent, die Lehrer kapierten das nicht, sie seien die Stumpfsinnigen, nicht ich, ich sei der Aufgeweckte, sie seien die Banausen.
Der Großvater ist Schriftsteller, wenn auch kein sehr erfolgreicher. Er lenkte seine Energie nicht in die Politik, sondern in die Literatur. Und er ist Anarchist. Anarchisten sind das Salz der Erde, sagte er immer wieder. Er hasst alle Autoritäten, die staatlichen ebenso wie die kirchlichen. Insbesondere die Katholische Kirche zog seinen Hass auf sich: Die katholische Kirche war ihm eine ganz gemeine Massenbewegung, nicht mehr als ein völkerverdummender und völkerausnützender Verein zur unaufhörlichen Eintreibung des größten aller denkbaren Vermögen. Sie beutet weltweit selbst die Ärmsten der Armen millionenfach aus nur zu dem Zwecke der unaufhörlichen Vergrößerung ihres Besitzes. Die Kardinäle und Erzbischöfe sind nichts anderes als skrupellose Geldeintreiber für nichts.
Entgegen der Mutter, die zeitlebens vergeblich versucht, in der bürgerlichen Normalität Fuß zu fassen, war der Großvater dieser Normalität von frühester Jugend an entflohen, für die er nichts als Spott und Hohn und die tiefste Verachtung übrig hatte. Er war von Halbgebildeten umgeben. Es ekelte ihn, wenn sie ihre Stimme erhoben. Bis an sein Lebensende haßte er ihren Artikulierungsdilettantismus. Wenn ein einfacher Mensch spricht, ist das eine Wohltat. Er redet, er schwätzt nicht. Je gebildeter die Leute werden, desto unerträglicher wird ihr Geschwätz.
Wir waren auf dem Seil gefangen, vollführten unsere Überlebenskunst, die sogenannte Normalität lag unter uns, wir trauten uns nicht, in die Normalität hineinzustürzen, weil wir wussten, dass dieser Kopfsprung unseren sicheren Tod bedeutet hätte.
Der Schriftsteller Hans Hartung schreibt über das Buch: Es ist vielleicht das schönste, das Bernhard geschrieben hat. Dem ist nicht zu widersprechen.
*
Als ich den Text von Thomas Bernhard las, erinnerte ich mich unwillkürlich an meinen eigenen Großvater. Sein erfahrungsgesättigtes Lebensmotto lautete: In der Welt ist es dunkel; leuchten müssen wir. Meiner war Schmied auf der Werft. Über 40 Jahre arbeitete er dort; unterbrochen nur durch seine unfreiwillige Teilnahme am Ersten Weltkrieg. Es war das einzige Mal, dass er seine Heimatstadt Emden verließ. In der Schlacht von Verdun wurde er schwer verwundet. Immer wieder erzählte er vom sinnlosen Stellungskrieg, in dem massenweise Menschen verheizt wurden. Menschen, die sich gar nicht kannten. Am Heiligen Abend hätten sie auf beiden Seiten der Front Stille Nacht gesungen, und am nächsten Tag habe man einander wieder tot geschossen. Harn wi doch een Spraak hatt, sinnierte er. Und immer wieder schimpfte er auf die Pfaffen, weil sie die Waffen der angeblichen Todfeinde segneten.
Oft berichtete er von seiner Verwundung und seiner wundersamen Rettung. Er erlitt einen Oberschenkeldurchschuss und wäre verblutet. Um Hilfe habe er geschrien, aber die Kameraden hätten ihn liegen lassen. Wir werden abgelöst, riefen sie ihm zu.Ein jüdischer Kamerad habe sich schließlich seiner erbarmt und ihm das Leben gerettet. Das war eines der prägenden Ereignisse seines Lebens.
Er hasste das Militär. Drill und Gehorsam waren ihm wesensfremd. Se tau, dat du noit daarhen must, pflegte er in seinem geliebten friesischen Platt zu sagen. Mein Opa war Gewerkschafter. Dass jemand ein guter Arbeiter war, auf den man sich verlassen konnte, das zählte für ihn. Er sparte nicht mit Kritik an der Politik der SPD. Die Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914 missbilligte er scharf. Man sei auf Wilhelm II. hereingefallen: Ich kenne keine Parteien mehr, nur noch Deutsche, habe dieser ausgerufen.Davon hätten sich viele blenden lassen.
Später sah er in der Spaltung der Arbeiterschaft einen entscheidenden Faktor für den Aufstieg des Nationalsozialismus. Dass Sozialdemokraten wie Gustav Noske und der Berliner Polizeipräsident Karl Zörgiebel Arbeiterdemonstrationen mit Hilfe von Freikorps blutig niederschlugen, machte ihn fassungslos. Er vermutete, dass auch die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von oben gebilligt worden war. Für ihn ein Wendepunkt in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Ich hörte deren Namen zum ersten Mal.
Schon früh erkannt er: Wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Mein Opa war kein Ideologe, hatte vielmehr einen unbestechlichen Blick für Realitäten. Den brauchte er auch. Es ging oft ums nackte Überleben: nicht nur im Ersten Weltkrieg, sondern auch in der Zeit des Faschismus. Durch kleine Widerstandshandlungen brachte er sich einige Male in große Gefahr. Er erhielt Verwarnungen, und einmal musste er einen Monatslohn Strafe zahlen. Er hatte „vergessen“, die braune Uniform der Werksfeuerwehr anzuziehen. Oder er weigerte sich, das Horst-Wessel-Lied mitzusingen. Nur die Lippen habe er bewegt – as’n Viss, de na Luft snappt. Und nur einmal habe er aus Überzeugung Heil Hitler gesagt. Ein fanatischer Nazi aus der Nachbarschaft, vor dem man sich hüten musste, war ausgebombt worden. Dem habe er ein Heil Hitler entgegen geschleudert. Ansonsten sei er bei seinem Moin Moin geblieben.
Als in den frühen 1950er Jahren die Diskussion um die Wiederbewaffnung aufkam, verfolgte er im Radio aufmerksam die Bundestagsdebatten. Einige davon hörten wir gemeinsam. Was ich nicht verstand, erklärte er mir mit einfachen Worten. Noch heute habe ich die Stimme von Fritz Erler im Ohr, der sich vehement dagegen aussprach.
*
Ein Höhepunkt des Jahres war jedes Mal der 1. Mai. Ich war sechs Jahre alt, als mein Opa mich zum ersten Mal zu einer Kundgebung mitnahm. Die Eindrücke sind mir unvergessen. Tagelang fieberte er dem großen Ereignis entgegen. Er war stets einer der Ersten am Treffpunkt. Immer dabei die Feuerwehrkapelle, die den Demonstrationszug durch die Stadt anführte. Auf dem Festplatz wurden Reden geschwungen und zum Abschluss Brüder zur Sonne zur Freiheit gesungen. Danach ging es in die Kneipe, wo Opa seinen Stammplatz hatte. Die Arbeiter diskutierten heftig über zu niedrige Löhne und lange Arbeitszeiten. Damals galt noch die 48-Stunden-Woche; gearbeitet wurde auch samstags.
*
Nachdem er in Rente war, saß er meistens auf seinem Lieblingsplatz am Fenster zur Straße. Ich sehe ihn noch sitzen. Hinter der halb geschlossenen Gardine. Auf seinem Thron, einem bequemen Lehnstuhl. Mittags und am späten Nachmittag zogen die Werftarbeiter in Scharen vorbei; sie hatten ihre Mittagspause oder Feierabend. Ick mutt mien Parade offnehmen, pflegte er zu sagen. Fast alle Vorbeiziehenden schauten zu ihm hoch und grüßten. Einige legten zum Gruß die Hand an den Mützenschirm. Opa grüßte huldvoll zurück. Die tägliche Zeremonie war seine Art der Verbundenheit mit den ehemaligen Kollegen. Während diese vorüber zogen, sinnierte er über den ein oder anderen. Der eine war kein guter Arbeiter gewesen, der andere politisch unzuverlässig. Er kannte seine Pappenheimer.
*
Ich leistete meinem Opa nach dem Tod seiner Frau oft Gesellschaft, was er zu schätzen wusste. Ich wurde sein Vertrauter. Er erzählte aus seinem Leben, und bald kannte ich jede seiner Geschichten auswendig. Ich liebte sein ostfriesisches Platt. Besser als im Hochdeutschen ließen sich damit feine Nuancen ausdrücken; Spott, Ironie aber auch Distanz und Verachtung. Ich nahm mir vor, seine Geschichten irgendwann aufzuschreiben. Über 50 Jahre nach seinem Tod habe ich meinen Vorsatz realisiert. Mein Buch Opas Welt. Erinnerungen an meinen Opa und meine Kindheit in Emden erschien vor 10 Jahren bei Books on Demand.
Ein schönes Erlebnis hatte ich, als mich die AG Ü-60 der Emder SPD einlud, aus dem Buch zu lesen. Zu meiner Überraschung kamen ca. 70 bis 80 Zuhörer: darunter ehemalige Nachbarn, Werftarbeiter, Freunde aus meiner Fußballzeit und frühere Arbeitskollegen. Nach der Lesung fingen einige an, von ihren eigenen Erinnerungen an die Werft zu erzählen, die es zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gab.
*
Beim Versuch, diese beiden Großväter, den von Thomas Bernhard und meinen eigenen, zu vergleichen, stellen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus: Der von Thomas Bernhard war weltläufig und verfügte als Schriftsteller über eine ausgeprägte Bildung. Mein Opa war bodenständig und hatte nur die Volksschule besucht. Aber beide Großväter waren gute Lehrmeister; sie haben jeweils auf ihre Art und nach ihren Möglichkeiten den Grundstein für politische Orientierungen bei den Enkeln gelegt; dazu gehört ihre zutiefst ablehnende Haltung zu Militär und Krieg, Befehl und Gehorsam, ihre Kritik an überflüssigen sozialen Hierarchien sowie ihr kritisches Urteilsvermögen.. Insgesamt gesehen vermittelten sie Lebensweisheiten, die man in Schule und Elternhaus nicht erfuhr. Sie verachteten jegliches Duckmäusertum und lehrten einen den aufrechten Gang. Daher kann man sie mit Fug und Recht wahre Philosophen nennen.
Bildquelle: Pixabay, Bild von cocoparisienne, Pixabay License