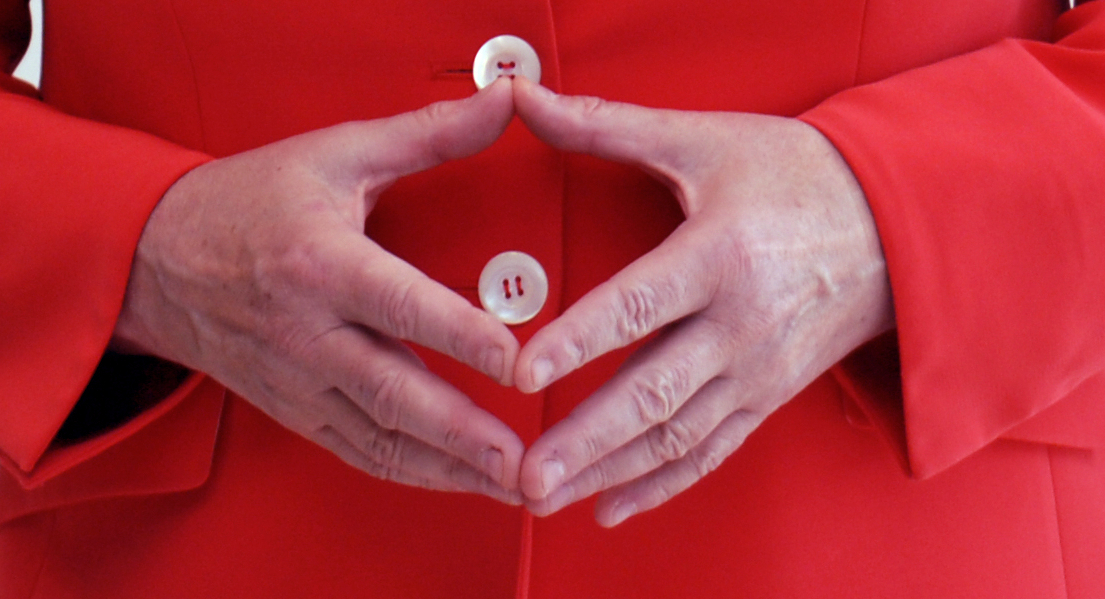Alle, die versuchen, gesellschaftliche Zustände oder das eigene Leben zu verändern, sind in gewisser Weise Suchende, die sich ins Ungewisse aufmachen ohne zu wissen, wo sie ankommen. Udo Lindenberg, der dieser Tage seinen 75. Geburtstag feierte, hat seine Suche nach einem ihm gemäßen Leben in seiner gewohnt lässigen Art auf den Punkt gebracht: Ich mach mein Ding, egal was die Anderen labern. Bei ihm ging ein Bruch mit dem Herkunftsmilieu voraus; aber er besaß Kraft, Mut und Durchhaltevermögen. Es war ein riskanter Weg ohne Rückfahrkarte.
Wir sehen: Suchende sind immer auch Hoffende; sie hoffen darauf, dass sich die Dinge zum Besseren wenden mögen.
*
Das Phänomen der Suche ist eine Erscheinungsform der Moderne. In traditionellen Gesellschaften sind der Status des Einzelnen und seine Rolle in der Gesellschaft durch Stand und Geburt festgelegt. Daraus gibt es kein Entrinnen. Die klassischen bürgerlichen Romane und Dramen sind voll von Beispielen. Neben der Herkunft ist es die Religion, die über Jahrhunderte zur Stabilisierung traditioneller gesellschaftlicher Verhältnisse beiträgt, indem sie die sinnstiftenden Orientierungen liefert.
Beides spielt in der modernen Gesellschaft, die auch gern als offene Gesellschaft bezeichnet wird, nur noch eine untergeordnete Rolle, auch wenn bis heute etwa die soziale Herkunft immer noch starken Einfluss auf den Bildungs- und damit Lebensweg eines Menschen hat. Aber dennoch: Mit dem Verlust allgemein verbindlicher Werte und Orientierungen sind die Menschen mehr als früher auf sich selbst gestellt und bis zu einem gewissen Grade auch dafür verantwortlich, was sie aus ihrem Leben machen. Das zumindest ist das Freiheitsversprechen der Moderne.
In der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist das Alltagsleben der meisten Menschen durch Routinen und Gewohnheiten geprägt, denen sie nur schwer ausweichen können. Imre Kertész. der als 15Jähriger nach Auschwitz verfrachtet wurde, hat in seinem Galeerentagebuch diesen Sachverhalt beschrieben. Er war ein unbestechlicher Beobachter der zeitgenössischen Lebensweise. Er kritisierte die sinnlose Zeitverschwendung, und dass wir den größten Teil unseres Lebens mit überflüssigen Dingen verbringen: Das morgendliche Aufstehen, danach die Hygiene, die Familie, dann die Verkehrsmittel; acht Stunden Arbeit – meist eine nicht zur Existenz gehörende, unwesentliche Tätigkeit –, danach der Einkauf, nochmals die Verkehrsmittel, ein wenig – die Existenz möglichst wieder nicht berührende – Zerstreuung. Das Leben verleben, ohne dass sie überhaupt teilnehmen an ihrem Leben, und müssen das, was geschieht, schließlich dennoch als ihr Leben betrachten.
Viele bewegen sich wie in einem Laufrad und merken vielleicht gar nicht mehr, dass sie nur noch funktionieren. Diesen Zustand kann man als Seinsvergessenheit (Heidegger) bezeichnen; die Menschen kommen gar nicht mehr dazu, innezuhalten und über ihr Leben nachzudenken. Sie flüchten in Scheinwelten, wie sie in unserer Konsum- und Freizeitgesellschaft im Übermaß angeboten werden. Es ist verständlich, warum diese Art der Suche in der Regel scheitern muss: Inhalt und Ziel der Suche bleiben diffus oder, wie Wladimir Nabokov sagt: Die Suche hat sich vor das Ziel geschoben. Die Suche ist solange reiner Selbstzweck, als die Menschen nicht wissen, wonach sie eigentlich suchen. Wenn sie das wüssten, wäre es schon keine Suche mehr, da es nur noch darum gehen würde, Mittel und Wege zu finden, um das Ziel ihrer Suche zu erreichen.
Sich der Möglichkeit der Suche bewusst zu werden, ist ein voraussetzungsvoller Vorgang oder, wie Walker Percy sagt: Die Suche ist etwas, das jeder unternähme, wäre er nicht in die Alltäglichkeit seines Lebens versunken. In seinen Romanen (Liebe in Ruinen, Der Idiot des Südens, Der Kinogeher) schildert er meist Angehörige der oberen amerikanischen Mittelschicht, deren Alltag perfekt durchorganisiert ist; alles ist bis ins kleinste Detail geregelt und damit vorbestimmt. Materiell besitzen sie alles, und doch empfinden sie ein Gefühl der Leere, der Langeweile und des Überflüssigseins. Sie sind gewissermaßen wunschlos unglücklich und werden zu Dauergästen der zahlreich vorhandenen Psychiater.
*
Es sind oft besondere, unvorhergesehene Ereignisse – z.B. ein Schock-Erlebnis oder eine Grenzerfahrung wie eine schwere Krankheit, Arbeitslosigkeit, der Tod eines nahestehenden Menschen oder Kriegserlebnisse – wodurch Menschen veranlasst werden, ihre Situation zu verändern und sich auf die Suche zu begeben. Sie fangen an, über ihr bisheriges Leben nachzudenken, bewusster zu leben und die Zeit sinnvoller zu nutzen. Kurzum: es ist der Entschluss, den Alltagsroutinen, der Langeweile, ja der Verzweiflung zu entkommen und dem Leben eine neue Richtung zu geben.
Zwei Typen von Suche lassen sich nach Percy unterscheiden:Als vertikale Suche bezeichnet er eine Sinn- oder Verstehenssuche; manche fangen z.B. an, grundlegende Bücher zu lesen, um die Entstehung des Lebens oder die Zusammenhänge des Universums zu verstehen und hoffen, dass sich ihnen auf diese Weise der Sinn ihres Daseins offenbart.
Als horizontale Suche bezeichnet er die Suche im Raum. Bei dieser geht es dem Suchenden darum, die Umgebung, in der er lebt, bewusster wahrzunehmen, auf die kleinen, unscheinbaren Dinge zu achten, die ihm täglich begegnen und die bisher unbeachtet geblieben sind: die Blumen am Wegesrand; der Gesang der Vögel oder die Vollkommenheit eines Baumes.
Ein besonderer Typ des Suchenden ist der Künstler. Seine Art der Suche hat Pablo Picasso wie folgt formuliert: Ich suche nicht – ich finde. Suchen, das ist das Ausgehen von alten Beständen und das Finden-Wollen von bereits Bekanntem. Finden, das ist das völlig Neue. Alle Wege sind offen, und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die im Ungeborgenen sich geborgen wissen, die in der Ungewissheit geführt werden, die sich vom Ziel ziehen lassen und nicht selbst das Ziel bestimmen.
*
Vielleicht ist es der Prozess des Suchens selbst, auf den es ankommt. Dann wäre die Suche eine Art Lebensauffassung oder Haltung, die Dinge um sich herum bewusster wahrzunehmen, Empathie für andere zu empfinden, sich um sie zu kümmern. Wie kaum ein anderer hat der Regisseur Ken Loach in seinen Filmen solche Menschen dargestellt; z.B. in Ich Daniel Blake. Ein Meisterwerk der Sozialkritik. Geschildert wird der vergebliche Kampf eines englischen Arbeitslosen gegen den Behördenirrsinn in der Folge der sogenannten Arbeitsmarkt“reformen“. Loach schafft es, den vergeblichen Kampf kleiner Leute um ein wenig Würde und Anerkennung ohne Sentimentalität oder Sozialromantik darzustellen. Immer gibt es in seinen Filmen kleine Inseln der Freundschaft und Solidarität als Gegengewicht gegen übermächtige, seelenlose, intransparente bürokratische Strukturen, denen der Einzelne ausgeliefert ist, weil undurchschaubare Mechanismen das Ganze beherrschen. Kafka lässt grüßen – seine Visionen sind in den Filmen von Ken Loach Realität geworden.
Dadurch unterscheidet sich der Suchende vom normalen Alltagsmenschen. Letzterer sucht gar nicht erst nach einem Ausweg; er nimmt die Dinge als gegeben hin; resigniert; fügt sich in sein Schicksal. Er empfindet womöglich nicht einmal Verzweiflung über seine Situation. Denn: Das Besondere der Verzweiflung ist eben dies: sie weiß nicht, dass sie Verzweiflung ist (Sören Kierkegaard).
Das Gegenstück zum Suchenden ist der Gleichgültige; er ist jemand, der nie versucht hat, etwas zu finden, sein Leben zu ändern; vielleicht hat er das Suchen auch ganz einfach aufgegeben. Dieter Wellershoff charakterisiert ihn wie folgt: Der Gleichgültige ist abgestumpft. Er leidet unter einer Art Affektlähmung, und das geht zusammen mit einem Wirklichkeitsverlust, einer Verflachung der Erfahrung. Ideen oder Utopien sind ihm nicht wichtig. Ihm fehlen ein Ziel und ein sinnstiftender Zusammenhang. Für ihn ist das Leben Faktizität, es besteht aus Momenten, Gewohnheiten, Bedürfnissen, sinnlichen Befriedigungen, und das Ganze erscheint ihm als ein absurdes Schauspiel. Genauso gut könnte das alles nicht sein oder anders, es ist aber, wie es ist.
Einen solchen Typ stellt Albert Camus in seinem Roman Der Fremde dar. Die Hauptfigur Mersault, ein Prototyp des Gleichgültigen, hat sich im Leben eingerichtet. Er glaubt nur an das, was er hat, anfassen und schmecken kann – alles andere: Hoffnungen, Ziele, Ansprüche oder Pläne, sind ihm fern. Der Zustand der Welt ist ihm egal. Er interessiert sich nur für sich. Wellershoff sagt über ihn: Er verharrt in der Attitüde der gefrorenen Reaktion. Die scheinbar sichere Identität des Gleichgültigen beruht auf Verzicht. Stellt sich zum Schluss die Frage: Ist der Suchende der glücklichere Mensch? Das ist schwer zu sagen. Immerhin: Er hat die Routine des Bescheidwissens überwunden und versucht, seine eigene Sicht der Dinge zu erlangen. Das ist eine Voraussetzung dafür, auf die Spur zu kommen. Wohin diese ihn führt, ist ein Prozess mit ungewissem Ausgang. Wie heißt es doch: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wer die Suche aufgegeben hat, dem bleibt angesichts des Zustands der Welt nur die pure Verzweiflung. Oder, um mit Walter Benjamin zu sprechen: Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben.
Bildquelle: Pixabay, Bild von Free-Photos auf Pixabay License